| 01_ | |
|
Zusammenfassung des Beitrags hier eingeben...
|
|
|
|
 |
|
Zusammenfassung des Beitrags hier eingeben...
|
 |
|
|
Eine der wichtigsten Grundlagen für das heutige Hauzenberg legte Bischof Gottfried von Weißeneck (1342-1362) im Jahr 1359 durch die Verleihung der Marktrechte. Dieses geschichtsträchtige Ereignis, das sich im Jahr 2009 zum sechshundertfünfzigsten Mal jährte, markierte den endgültigen Übergang Hauzenbergs in die fürstbischöfliche Zeit.
|
|
|
|
 |
||||||
|
||||||
|
650 Jahre Marktrechte in HauzenbergWie in vielen anderen Ortschaften wurden auch in Hauzenberg die Grundlagen für den Ort bereits im Mittelalter gelegt. Die heutige Stellung und Bedeutung Hauzenbergs hat seine Wurzeln also in einer bereits recht weit zurückliegenden Zeit, deren Zustände uns heute allerdings schon recht fremd geworden sind. Eine der wichtigsten Grundlagen war zweifellos die Verleihung der Marktrechte durch Bischof Gottfried von Weißeneck im Jahr 1359.
Der heutige Bestand der Hauzenberger MarktrechtsurkundenLeider ist die Urkunde aus dem Jahr 1359, in der die Hauzenberger Marktrechte zum ersten Mal schriftlich fixiert worden sind, verloren gegangen. Da aber die verliehenen Rechte und Freiheiten nur für die Dauer der Regierungstätigkeit des jeweiligen Fürstbischofs Gültigkeit hatten und diese Rechte somit von jedem neuen Fürstbischof neu bestätigt bzw. konfirmiert werden mussten, haben sich im Lauf der fast 6 Jahrhunderte unter bischöflich - passauischer Herrschaft eine Reihe solcher wertvoller Konfirmationsurkunden angesammelt, deren Inhalt über die Jahrhunderte nur geringfügig verändert wurde. Man kann so anhand der nachfolgenden Urkunden den Inhalt der ersten Marktrechtsurkunde erschließen. Im Jahr 1803 waren nach einem Repertorium, einem Findbuch aus dieser Zeit, sogar noch 19 Marktrechtsurkunden vorhanden. 7 sind also erst in den letzten 200 Jahren verloren gegangen. Die Urkunde von 1359 sogar erst in der Nachkriegszeit. Die von Gottfried von Weißeneck im Jahr 1359 verliehenen Rechte blieben über die Jahrhunderte bis zur Auflösung des Fürstentums Passau im Jahr 1803 im Wesentlichen unverändert. Die Hauzenberger wachten auch eifersüchtig darüber, dass ihnen diese Rechte nach Regierungsantritt eines neuen Landesherrn sofort wieder bestätigt wurden - womöglich noch zusätzlich mit einigen Ergänzungen versehen.
Der Inhalt der MarktrechtsurkundenWas den genauen Inhalt und das Aussehen der Marktrechtsurkunde von 1359 betrifft, so können wir auf die seltene und wertvolle Originalurkunde Bischof Leonhards von Layming aus dem Jahr 1426 zurückgreifen, die den Inhalt der Urkunde von 1359 wörtlich wiedergibt.
Original Pergament. Das ursprünglich an einer Kordel befestigte Siegel fehlt. Stadtarchiv Hauzenberg, 1/U0. Gleichzeitige Abschrift im Kopialbuch Bischof Leonhards: Bayer. Hauptstaatsarchiv München, Hochstift Passau Lit. 14, fol. 30-30´
Wir Leoart von Gots genaden bischoue ze Passaw bekennen offentlich mit dem brief allen den, die in ansehent oder hörent lesent, wie wol wir doch mit gutem willen allen unsern undertanen und getrewen geneigt sein, genade und fürdrunge ze beweisen, yedoch sey wir zu den höher geneygt, die sich allczeit gen uns, unsern vorvordern seliger gedechtnüsse und unserm Gottzhaws mit stetter und undertainiger trewe haben vinnden lassen. Wanne nu aber wir unser lieb getrewe unser burger gemeinlich zu Hawczenperg in vorgemellter trew funnden haben, die uns fürbrachten, weilent unsers lieben herren und vorvordern hern Gotfrieden die czeit bischofs ze Passaw seligs unvermeiligten brief, der klerlich innehalldet des vorgen(annten) unsers marckts recht und freyheit, der von wort czu wort also lauttet: Wir Gotfrid von Gots genaden bischoue ze Passaw, bekennen offentlich mit dem brief und tun kunnde allen den, die nu gegenwürtig sind und fürbas künfftig werdent, das unser getrew burger datz Hawczenperg für uns komen und habent uns gebeten, daz wir sy genedigklich bedachten mit ettlichen rechten, die sy fürbas stetigklichen hieten und das wir in dieselben recht mit unserm brief bestätten. Nu haben wir ir fleissig bete angesehen und haben sy mit guter betrachtung nach unsers rats rate bedacht und begenadet mit den rechten, die hernach geschriben steent. Des ersten, daz sy sullen haben auf wasser und auf lannde alle die recht, die unser burger von Passaw habent an (= ohne) allein daz sy richen und geben süllen die mautt von dem salcz, daz sy fürent. Darnach sol kain lanntgraff noch kein pfleger der klasterfrawen ze Nydernburg noch dhein burggrave oder richter noch nyemant annder hinncz in nichts zerichten haben, nur allein der oder die richter, den wir oder die wir in zu richtern besunnderlich setczen, also bescheidenlich, was die richter oder (der) richter, den oder die wir in setczen oder geben, nicht berichten möchten, das süllen wir selber richten und nyemant annders. Auch sol man hinncz in und hinncz irer habe weder ze Passaw noch in anndern steten noch gerichten, die uns angehörent umb gellte oder umb dhein solh ring sach dhein recht nicht suchen noch tun, nur allein vor irem richter, es wär dann alsvil, das der klager oder die klager redlich beweisen möchten, das derselb ir richter von in oder irer habe nicht recht tun wollde, als recht wer. Sy habent auch recht und gewallt, das sy all schedlich lewt eyln und vahen mügen, und süllen sy des allenthalben unschadhafft beleiben, wo sy die eylent oder begreiffent, und sullen auch sy dieselben schedlichen lewt, die sy begreiffent, nyemant antwurten, denn irem richter, und was dann habe funnden wurde bey solhen schedlichen lewten, die innerhalb der gemerckt zu Beheim begriffn wurden, derselben hab sol unsern vorgen(annten) burgern zwayteil beleiben und das dritteil derselben habe, das sol beleiben den dieselbe habe genomen und empfürt ist. Wurden aber solh schedlich lewte begriffen innerhalb der gemerckt des lannds Beyrn, was sy dann habe bey denselben vinnden, der sol in beleiben das drittail. Sy sullen auch haben gewallt und recht zu verkaufen und ze füren flosholcz zwischen der Illcz und der Renna, als es von alllter gewonheit herkomen ist. Wir bestätten auch unsern egen(annten) burgern dacz Hawczenperg die vorgen(annten) rechte alle, als sy von wort ze wort hie oben geschriben sind, und geben in drüber zu ainem urkunnde den Brief, versigelten mit unserm anhangunnden insigl, der geben ist ze Passaw, am pfinntztag vor Egidi nach Christs geburde drewczenhunndert jar und darnach in dem newnundfünnfczigsten jar. – Nu baten uns die vorgemelltten unser burger diemuütigklich, das wir in solh vorgen(annte) brief, privilegia und freyheite genedigklich geruchten zu verneuen und bestätten. Haben wir angesehen derselben unser burger getrew dinst und haben in die vorgenan(nten) ir brief,privilegia undm freyheit in alleniren punnten und artikeln bestett und vernewet, bestetten und vernewen die auch mit guter gewissen in krafft ditcz brief,also daz sy dabey in künfftigen czeiten ungehinndert beleiben süllen, getreulich und an alles geverde. Mit urkunde ditcz brief, geben ze Passaw an pfinncztag nach sand Bartholomeustag des heiligen zwelifpoten nach Christs gebürde vierczehenhunndert und in dem sechsundczwainnczigisten jaren.
Insgesamt wurden den Hauzenbergern darin neben neuen Rechten auch ältere, längst bestehende Freiheiten und Privilegien bestätigt; das heißt, dass Hauzenberg nicht erst im Jahr 1359 ein bedeutender Zentralort geworden sein kann, schon gar nicht, dass der Ort erst damals zu existieren begann.
1. Gleichstellung der Hauzenberger mit den Passauer Bürgern Neu war für die Hauzenberger jetzt allerdings, dass sie in ihren Rechten den Passauer Bürgern gleichgestellt wurden. Sie erhielten damals die gleichen Handelsvorrechte „zu Wasser und zu Land“, so der Wortlaut, wie die Bürger von Passau. Von da an konnten sie also auf bischöflichem Territorium unbegrenzt Handel treiben und brauchten keinerlei Mautgebühren entrichten.- Mit einer einzigen Ausnahme, der Salzmaut, die sie an Niedernburg zu zahlen hatten. („allein daz sy richen und geben süllen die mautt von dem salcz, daz sy fürent“).
Die Gleichstellung mit den Passauern brachte den Hauzenbergern neben Handelsvorteilen auch einen beachtlichen Prestigegewinn, wurden sie doch nun mit den Passauer Bürgern auf eine Stufe gestellt. Dennoch blieben die Hauzenberger, wie die alten Akten im Stadtarchiv zeigen, über die Jahrhunderte bodenständig und schielten nicht neidisch auf die Passauer Bürgerschaft. Sie galten bis ins vorige Jahrhundert hinein als sogenannte Ackerbürger, die neben ihrem Gewerbe als 2. Standbein noch eine zumeist kleinere Landwirtschaft betrieben. Sogar der Pfarrer war bis ins 19. Jh. hinein gleichzeitig Seelsorger und Ökonom. Vermutlich steckt hinter dieser Gleichsetzung mit den Passauer Bürgern auch die Absicht des Bischofs, damit loyale und bischofstreue Neubürger zu finden, die ihn im erbitterten Kampf, den er seit langem gegen die Passauer Bürger führte, unterstützen konnten.
2. Die niedere Gerichtsbarkeit Zeichen und Ausdruck des gehobenen, freieren Standes der Hauzenberger Neubürger war auch, dass sie mit den Marktrechten nun die niedere Gerichtsbarkeit erhielten. Damit konnten sie ihre rechtlichen Angelegenheiten, mit Ausnahme der schweren Fälle, selbst regeln. Sie waren von da an weder dem bischöflichen Landrichter, noch dem Richter der Klosterfrauen von Niedernburg, auch nicht Richtern des hier ansässigen Adels, der Hauzenberger oder der mit ihnen verwandten Päschinger unterworfen. Hauzenberg erhielt jetzt einen eigenen, vom Bischof eingesetzten Marktrichter, der an den Gerichtstagen, jeweils an einem Mittwoch, unterstützt von 4 Räten, Ratsgeschworenen oder Vierern, wie sie auch genannt wurden, zu Gericht saß.
Die Amtssitze der Hauzenberger Richter Als erster Richter von Hauzenberg ist aus dem Jahr 1372 ein gewisser „Friedrich“ überliefert. Er und seine Nachfolger hatten zunächst ihren Sitz auf der Burg Freudensee.
Freudensee war gleichzeitig Sitz eines Pfleg- und Marktgerichts. Die dortigen Pfleger und Marktrichter hatten deshalb auch das Malefiz- und Halsgericht, d.h. sie konnten sogar Todesurteile vollstrecken. Gerichtsplatz war der Galgenacker, der sich am Kalvarienberg befunden haben soll. Um 1540 wurde die Burgpflege Freudensee aufgegeben und das Richteramt von da an mit angesehenen Hauzenberger Bürgern besetzt. Die richterliche Kompetenz wurde damals auf die niedere Gerichtsbarkeit beschränkt. Unter den Marktrichtern tauchen dann im Lauf der Jahrhunderte auch Familiennamen auf, die den älteren Hauzenbergern noch heute geläufig sein dürften, wie z.B.: die Ertl, Sterl, Kaiser, Augustin, Griebl, Gottinger Friedl, Lang, Baumgartner und wie sie alle hießen. Ihr Amtssitz war von da an das Amts- oder Gerichtsdienerhaus an der Marktstraße 12, das um die Mitte des 16. Jahrhunderts neu errichtet wurde.
Es war das erste öffentliche Amtsgebäude in Hauzenberg und Sitz des Marktrichters sowie des Marktschreibers. Hier war auch das sog. Arrestlokal, das Gefängnis von Hauzenberg untergebracht.
Der Pranger als Symbol der niederen Gerichtsbarkeit der Märkte Symbol für diese niedere Gerichtsbarkeit der Märkte war seit dem Spätmittelalter der Pranger, der in Hauzenberg bis Mitte des 19. Jahrhunderts an der Stelle des heutigen Marktbrunnens stand. Er ist heute leider spurlos verschwunden, aber ein sehr gut erhaltenes Exemplar eines solchen Prangers ist noch heute im Nachbarmarkt Untergriesbach zu bewundern.
Die Praxis der marktrichterlichen Tätigkeit in Hauzenberg Die Fälle, über die die Marktrichter zu richten und zu befinden hatten, geben einen kleinen Einblick in das Leben der Hauzenberger in fürstbischöflicher Zeit.
Überliefert ist uns das Ganze in den Verhör- und Strafprotokollen, die seit dem Jahr 1612 noch heute im Stadtarchiv vorhanden sind. Es geht darin häufig um Schuldforderungen der Hauzenberger, Verletzungen der Wässerungsrechte auf ihren Wiesen, Beleidigungen, Beschimpfungen, Tanzbodenraufereien und auch Saufereien. Der Marktrichter hatte dabei nicht die Rolle eines gefürchteten Strafrichters, sondern die des Friedensrichters und Streitschlichters zu spielen. Die Leute kamen oft mit geradezu lächerlichen Streitereien zu ihm und nur selten wurden böse Weiber mit dem Schließholz um Hals und Handgelenke an den Pranger gestellt oder das „Streichen“ mit Ruten bei besonders bösartigen Weibspersonen angeordnet.
Bei Männern war das Einsperren bei Brot und Wasser im Gefängnis des Amtshauses die häufigste Strafe. Die gängigste Ausrede bei den Arrestanten lautete dabei: „ich weiß nichts davon, denn ich bin toll und voll gewesen.“
Insgesamt aber ist diesen Protokollen zu entnehmen, dass sich die Richter und Geschworenen redlich um einen Ausgleich bemühten. Geldstrafen spielten dabei eine bevorzugte Rolle, denn sie waren ja auch eine gute Einnahmequelle. Dennoch kritisiert der Landrichter in Passau wiederholt, dass zu viele Fälle an das Landgericht überwiesen würden und er mahnte die Marktrichter mehrmals, als „iudices primae instantiae“ , als erste Instanz, von ihrem Recht auch entsprechend Gebrauch zu machen.
3. Rechte und Privilegien der Hauzenberger, die auf die Zeit vor der Marktrechtsverleihung zurückgehen Neben der niederen Gerichtsbarkeit erhielt Hauzenberg im Jahr 1359 auch 2 Privilegien bestätigt, die auf frühere, althergebrachte Rechte der Hauzenberger zurückgehen:
Das eine gestattete es den Hauzenberger Bürgern, gegen entsprechendes Entgelt sog. „schädliche Leute“ bis nach Bayern und Böhmen hinein zu verfolgen, einzufangen und ihrem Richter zu übergeben.
Das 2. bereits auf die vorpassauische Zeit zurückgehende Privileg bestätigte den Hauzenbergern das Recht, zwischen Ilz und Ranna Floßholz zu kaufen und zu führen, „als es“ –so wörtlich- „von alter Gewohnheit herkommen ist“. Von diesem Recht wurde über die Jahrhunderte auch reger Gebrauch gemacht und noch in einer Notiz aus dem Jahr 1519 heißt es, dass "fast täglich ob hundert Wägen von den oberen Wälden Waldkirchen und Hawtzenberg mit Holzwerch in die Zell faren.“ Obernzell war ja über die Jahrhunderte zentraler Handelsplatz und Umschlaghafen für die Produkte aus dem südlichen Abteiland, die donauabwärts verhandelt wurden.
4. Das Bürgerrecht als grundlegender und selbstverständlicher Bestandteil der Marktrechte Die Hauzenberger werden im ersten Freiheitsbrief von 1359 zwar als Bürger bezeichnet, aber was dieses Bürgerrecht im Detail beinhaltete, wurde vermutlich als Selbstverständlichkeit angesehen und deshalb nicht näher ausgeführt. Die Urkunde von 1359 nennt nur die wichtigsten Rechte eines Marktes, die ihn von einem Dorf unterschieden. Zusammengefasst waren dies
Im Einzelnen garantierte das Bürgerrecht den Hauzenbergern aber auch
Das Bürgerrecht sicherte den Marktbürgern also auch Monopolrechte auf dem Gebiet des Handels, Handwerks und Gewerbes zu. Die Bauern des zugehörigen Gebietes durften deshalb nur hier auf dem Marktplatz ihre landwirtschaftlichen Produkte anbieten, sie konnten sich hier mit den notwendigsten Dingen eindecken und nur hier durfte Bier gebraut und ausgeschenkt werden.
Die Jahr- und Wochenmärkte als Teil dieser Handelsprivilegien Das an sich selbstverständliche Recht der Märkte, Jahr- und Wochenmärkte abzuhalten, wurde erst ab dem 16. Jahrhundert in den Marktrechtsurkunden auch schriftlich fixiert. Vermutlich, um so durch die aufeinander abgestimmten Termine eine unnötige Konkurrenz mit den anderen Märkten des Abteilandes zu vermeiden. Haupthandelsgüter auf dem Markt in Hauzenberg waren Hopfen, Leinwand und Mastochsen.
Erstmals wird den Hauzenbergern in der Marktrechtsurkunde vom 9. März 1558 ausdrücklich das Recht zugesichert, allwöchentlich am Pfinztag, also am Donnerstag, einen Markt abzuhalten. Im Freiheitsbrief vom 12.12.1558 wurde dieser Markttag dann vom Pfinztag auf den Erchtag = Dienstag verlegt. Das Marktrichteramt beinhaltete also sowohl die Kompetenzen eines Richters als auch eines Notars. - Das geht weit über das hinaus, was ein heutiger Bürgermeister an Rechten und Befugnissen hat.
Im Lauf der Jahrhunderte hatten es die Hauzenberger verstanden, neben dem genannten Wochenmarkt am Dienstag noch weitere Jahrmärkte bewilligt zu bekommen:
Die Praxis der Jahrmärkte in Hauzenberg Bei den Jahrmärkten wurde auch noch im 18. und 19. Jahrhundert ein Stück Mittelalter wieder lebendig und man kann zumindest erahnen, wie unsere Vorfahren unter den Vorgaben der fürstbischöflich passauischen Marktrechte hier in Hauzenberg in den vorausgegangenen Jahrhunderten gelebt haben.
Die Menschen strömten bei den großen Jahrmärkten aus nah und fern herbei und füllten den Marktplatz. Da lockte nicht nur ein vielfältiges und buntes Warenangebot, sondern auch Unterhaltung, Informationen und Nachrichten aus aller Welt. In einer Zeit, in der es noch kaum eine Zeitung, geschweige denn Rundfunk oder Fernsehen gab, war das Marktreiben auch die wichtigste Informations- und Nachrichtenbörse. Der Kirta war das große Spektakel; er war beinah die einzige und daher sehnsüchtig erwartete Abwechslung im ländlichen Alltag. Kinder wie Erwachsene freuten sich während der anstrengenden Arbeitswochen auf diesen Tag; dafür sparte selbst der Ärmste ein paar Groschen und leistete sich auch einmal ein Lüngerl und eine Maß Bier in einem der damals noch zahlreichen Wirtshäuser des Marktes. Den Gewerbetreibenden im Markt, die sonst vorwiegend auf Bestellung arbeiteten, gaben die Jahrmärkte aufgrund des großen Andrangs von Käufern auch Gelegenheit, für den Verkauf zu arbeiten, ihre Ware auszustellen und anzubieten. Die meisten Marktbuden besetzten in der Regel aber auswärtige Händler, die Fieranten, wie sie damals hießen, aus der näheren und weiteren Umgebung. Dazu kamen Schausteller, wandernde Gaukler und Moritatensänger. Da aber die einheimischen Anbieter mit den auswärtigen Händlern konkurrieren konnten, bot eine starke auswärtige Beteiligung sogar Vorteile, denn die fremden Händler und das begleitende Unterhaltungsprogramm vergrößerte das Interesse der Landbevölkerung an den Jahrmärkten und steigerte so die Besucherzahlen.
Die Verteilung der Kramerstände auf dem Marktplatz in Hauzenberg ist aus den Aufzeichnungen von 1802-1838 überliefert. Es heißt dort, dass zwischen der Brauerei und dem damaligen Kirchhof, sowie auf der gegenüberliegenden Seite jeweils 5 Reihen von Ständen errichtet waren, westlich davon, beim damaligen Pranger und heutigen Marienbrunnen, standen 3 Reihen und östlich davon gab es noch einmal 2 Zeilen von Ständen. Insgesamt waren an jedem Markttag etwa 60 Stände, auf dem Marktplatz belegt. Etwas abseits, vermutlich im Hof neben und hinter dem Schwarzen Adler, befand sich der Schweinemarkt.
Um den Bauern die Gelegenheit zu geben, ihr Vieh auf dem Markt zu verkaufen, wurden seit der Mitte des 16. Jh. in den Märkten des Hochstifts auch eigene Markttage für das Mast- und Magervieh angesetzt. Der sog. Fürkauf, bei dem die Händler direkt bei den Bauern auf den Dörfern kauften und so den Markthandel umgingen, war streng verboten.
In unserer Region bildete der Verkauf fetter Ochsen die Haupteinnahmequelle der Bauern früherer Jahrhunderte. Die Mastochsen aus der Hauzenberger Gegend hatten einen sehr guten Ruf und so fanden sich auf den Märkten neben den einheimischen und den Passauer Metzgern auch viele auswärtige, ja sogar ausländische Metzger und Händler ein. Nach einem Bericht aus dem 16. Jh. kamen die Händler aus Landshut, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und sogar aus Italien. Der Ablauf dieser Viehmärkte war dabei genau geregelt: Zuerst durften nur die einheimischen Metzger und Händler einkaufen. War ihr Bedarf gedeckt, wurde gegen Mittag das Marktzeichen, ein auf eine Stange aufgesteckter Strohschaub, abgeworfen. Jetzt begann der 2. Markt, auf dem auch die Auswärtigen kaufen konnten.
Nach einem Verzeichnis vom 9. März 1558 wurden damals z. B. 263 Paar Ochsen verkauft. Aufgetrieben waren insgesamt 535 Paar.
Die Bedeutung der Marktrechte für HauzenbergWill man die Bedeutung der Marktrechtsverleihung durch den Passauer Fürstbischof im Jahr 1359 zusammenfassend bewerten, so ist festzuhalten, dass die Marktrechte insgesamt Ausgangspunkt und Voraussetzung für eine lange und gedeihliche Entwicklung Hauzenbergs unter dem Krummstab des Passauer Bischofs waren. Das bischöfliche Marktrecht brachte den Hauzenbergern Handelsvorteile, Prestigegewinn, Rechtssicherheit, militärischen Schutz und Beständigkeit. Ausgestattet mit den passauischen Marktrechten konnte Hauzenberg seinen Status als Zentralort festigen und ausbauen. Auch die heutige Stellung und Bedeutung Hauzenbergs gründet sich auf eine 650 jährige Tradition als Markt. Selbst für die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1978 war dieser Marktstatus wesentliche Voraussetzung.
Die Gründe, die den Passauer Bischof bewogen haben, Hauzenberg Mitte des 14. Jahrhunderts in die Passauer Marktrechtsfamilie einzureihen, sind vielfältig. Die auffällige Privilegierungswelle, die Mitte des 14. Jh. auch eine Reihe von anderen Orten wie Wegscheid, Kreuzberg und Perlesreut zu Märkten erhob, dürfte zum einen mit dem Kampf des Bischofs gegen die Passauer Bürger zusammenhängen. Der Bischof wollte damals offensichtlich in den Märkten ein Gegengewicht gegen die aufmüpfigen Städter schaffen. Zum anderen aber machte es vermutlich auch die kurz vorher abgeklungene Pestepidemie, die seit 1348 die mitteleuropäische Welt in ihren demographischen Grundlagen erschüttert hatte, notwendig, bürgerliche Siedlungen und die Mittelpunkte des Landes wieder zu stärken. Besonders zu erwähnen aber ist in diesem Zusammenhang die internationale Politik des damaligen Kaisers Karls IV., der sein böhmisches Territorium durch zahlreiche Verkehrs- und Handelsaktivitäten stärker zu einem Mittelpunkt des Reiches machen wollte. Offensichtlich versuchte damals auch der Passauer Bischof sein Territorium durch die Privilegierung einer Reihe von Ortschaften für die Herausforderungen des internationalen Handels jener Epoche zu rüsten.
Mit der Erhebung zum Markt durch Bischof Gottfried von Weißeneck wurde die damals zweifellos bereits bestehende zentralörtliche Funktion Hauzenbergs bestätigt und unterstrichen. Die Verleihung der Passauischen Marktrechte bildete also auch eine Würdigung der besonderen Stellung und Bedeutung, die Hauzenberg bereits in der vorpassauischen Zeit hatte. Diese wiederum dürfte zurückgehen auf die groß angelegte Besiedlungswelle des 11. und 12. Jahrhundert, die im 13. Jahrhundert im Raum zwischen Ilz und Ranna bereits zu einer Besiedlungsdichte führte, die bis ins 19. Jh. keine wesentlichen Veränderungen mehr erfuhr. Schon damals wurden die Ortschaften nicht willkürlich in der Landschaft verteilt, sondern zentralen Orten als wirtschaftliche und kirchliche Mittelpunkte zugeordnet, die in etwa gleichem Abstand zueinander lagen. Im Hauzenberger Raum war das Adelsgeschlecht der Hauzenberger für diese Erschließungsmaßnahmen zuständig.
Der Marktplatz als ältestes Denkmal von Hauzenberg Mit der Verleihung der Marktrechte begann für Hauzenberg die fürstbischöflich - passauische Zeit. Sie dauerte dann fast 6 Jahrhunderte und hat Land und Leute hier entscheidend geprägt.
Geblieben ist aus dieser Zeit der Marktplatz in seiner Gesamtanlage als ältestes Denkmal von Hauzenberg. Es war der Platz, auf dem sich über die Jahrhunderte das Wirtschafts- und Rechtsleben der Marktsiedlung und der umliegenden Ortschaften abgespielt hat. Unsere Aufgabe ist es heute, diesen Marktplatz als Ortszentrum und Zentrum der Begegnung in einem weit über seine früheren Grenzen hinausgewachsenen Ort zu erhalten und zu fördern. Auch wenn der Marktplatz heute seine ursprüngliche Funktion durch die Verlagerung der Einkaufsmöglichkeiten in die Peripherie des Ortes weitgehend eingebüßt hat. Ein wichtiger Beitrag dazu ist sicherlich die Verlegung des Rathauses in die Mitte des Marktplatzes, ins ehemalige Krennbräuhaus.
Die vielen vorausgehenden Generationen haben den Ort, sein Aussehen und Ansehen geprägt und uns ein lebens- und liebenswertes Gemeinwesen hinterlassen. Dieses Erbe gilt es zu bewahren und an die heutige Zeit anzupassen.
Textbeitrag: Georg Schurm |
||||||
 |
|
|
Vom Zeitpunkt der Marktrechtsverleihung an stand ein Richter an der Spitze von Kommunalverwaltung und Rechtsprechung. Seit Mitte des 16. Jhs. vertrat ein aus der Bürgerschaft rekrutierter Marktrichter die Interessen der „Hauzenberger Gmain“ und bildete zugleich das Bindeglied zum Landesherrn. Marktrichter verwalteten, unterstützt von Ratsgeschworenen, einem Amtmann, Marktschreiber und Nachtwächter den Markt bis zur Säkularisation im Jahre 1803.
|
|
|
|
 |
|
1. Richter zu HauzenbergZunächst wurde das Richteramt vom bischöflichen Pfleger im Schloss Freudensee versehen. Im Freiheitsbrief von 1426 [1] (Abschrift der Originalurkunde von 1359) ist ausdrücklich verfügt, dass allein der Bischof (als Landesherr) den Richter berufen kann. Er besaß die hohe Gerichtsbarkeit (Malefiz- und Halsgericht) und nahm neben den Richteramt auch Verwaltungsaufgaben im Hauzenberger Raum wahr. Namentlich bekannt sind:
1372: Friderich, Richter von Hautzenperg (Bay HstA, Passau-Niedernburg, U 240) 1416: Anndre von Anger, Pfleger von Frawdensee (Heider 1934, 285) 1425: Nykchlas der Hirsfelder, Richter zu Hauzenberg (Heider 1934, 233) 1434: Niclas der Hierssvelder, Richter zu Hautzenperig (Heider 1934, 103) (die Ergänzung erfolgt mit der fortlaufenden Bearbeitung) 2. Marktrichter und RatNach Aufhebung der Pflegschaft Freudensee, um die Mitte des 16. Jhs., vertrat ein aus der Bürgerschaft rekrutierter Marktrichter die Hauzenberger Gmain. Aus dem ab 1602 im Archiv vorliegenden Quellenmaterial sind die aus den Reihen der Hauzenberger Bürgerschaft ernannten Marktrichter namentlich bekannt – ab der Mitte des 17. Jhs lassen sie sich lückenlos auflisten. Sie sind bisweilen als „aufgestellt“ oder „erwählt“ bezeichnet. Ob sie tatsächlich von den Mitbürgern gewählt und vom Landesherrn bestätigt wurden, wie an anderer Stelle vermutet, wird zu klären sein. Jeder der Marktrichter hatte weiterhin wenigstens eine Gewerbsgerechtsame inne, des gleichen wurde eine kleine Landwirtschaft betrieben, die zur Versorgung des Grundbedarfes ausreichte. Ein kleiner Ausschnitt aus dem „Terminkalender“ des Marktrichters David Schaibinger (um 1630) gibt einen Einblick in sein Aufgabenprogramm:
(Mantag) Nachmittag, die Marckht Hänndl, Erchtag, den 30. die zwo Bschauen zu Penzenstadl Vormitag, Nachmittag, den Oxenmarckht, Mitwochn den 1. May, Nachmittag, Khirchen Raittungen, Pfinztag den 2. Vormittag die Marckht Ehehafft unnd die überigen Hänndl … (StAH 3/3).
Marktrichter besaßen die niedere Gerichtsbarkeit, zu ihren Aufgaben gehörte: » Ehehafttaiding: Jährlich gehaltener Gerichtstag mit Verlesung der Ehehaft und Marktrechte. » Marktverhör/Gerichtssitzungen (vgl. Strafprotokolle) Richard Miller hat bei der Abfassung der Geschichte Hauzenbergs die "schweren Vergehen" aus den Strafprotokollen zusammengestellt und unter einem eigenen Abschnitt, betitelt als als Rauf- und Saufexzesse, abgedruckt. ( Miller 1953, 38 ff.) » Beurkundung von Verträgen (z.B. Kauf, Verkauf, Übergabe) (vgl. Marktgerichtsprotokolle) » Inventur des Nachlasses (vgl. Nachlassinventare) » Gerhabsetzung: Bestellung von Vormundschaften » Mitsprache bei der Vergabe von Handwerksgerechtigkeiten » Marktaufsicht Unterstützung bei der Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten erhielt der Marktrichter von vier vereidigten Abgeordneten aus der Bürgerschaft, den Ratsgeschworenen (auch Ratsfreunde oder Ratsbürger). Lediglich unter der Amtszeit von Hans Augustin (1703-1710) war die Zahl auf sechs Mitglieder erhöht. In diesen sieben Jahren amtierten Sebstian Griebl (Leinweber), Adam Liebl (Fleischhacker), Andreas Sterl (Bäcker), Gabriel Mack (Schuhmacher), Johann Gottinger (Bäcker) und Andre Ertl (Leinweber). Gewählt wurden die Ratsgeschworenen von der Bürgerschaft – eine Aktion, die nicht immer ohne Turbulenzen abging. Als im Jahr 1672 im Bräuhaus „die Bürgerschaft die Ämter veränderte“ stellte der fürstliche Hofjäger Hans Heinrich den Bürgern die Frage, warum sie den Leinweber Simon Fesl, einen Perldieb, zum Ratsgeschworenen erwählt hätten. Eine delikate Anschuldigung vor aller Öffentlichkeit, zu einer Zeit als die Perlenfischerei ein Herrschaftsrecht war. Für Simon Fesl stand die Aberkennung der bürgerlichen Rechte auf dem Spiel. Als dann die Wahl auf den Bader und Wundarzt Bartholomäus Steyer fiel, meinte der Bäcker Görg Mayer, „man hat die Bader aussen nit gern, man hätts in Stätten und anderwärts gar verächtlich“. Damit fühlte sich das Handwerk der Bader und Wundärzte angegriffen, die nach ihrer eigenen Einschätzung überall „für ehrlich aufgenommen werden“. StAH 3_5 Nur wer den Status „Bürger“ genoss, besaß das Wahlrecht, durfte aber auch selbst ein Amt bekleiden. Im 17./18. Jh. traf dies auf gut 50 „Hauzenberger“ zu. Es verlangte sicherlich Gemeinschaftssinn aus dieser Runde 5-7 Mann an die Spitze zu stellen.
Zu den Aufgaben der Ratsgeschworenen gehörten: » die Schätzung von Schäden, die von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Mitbürger angerichtet wurden, » die Lebensmittelbeschau (für Fleisch, Brot und Milchprodukte) » die Rauchfangbeschau (Feuerstättenbeschau). » Sie waren Beisitzer beim Marktgericht » Zeugen bei Vertragsabschlüssen die vor dem Marktrichter getätigt wurden (Übergabe, Donationen, Schuldbriefe, Kauf und Verkauf) und » nahmen mit dem Marktrichter die Inventarisation der Hinterlassenschaft vor. Aus den Reihen der Ratsgeschworenen wiederum wurde jeweils der Marktrichter bestimmt.
Anhand der Bestände im Stadtarchiv lässt sich die Liste der Hauzenberger Marktrichter und Marktschreiber ab der Mitte des 17. Jhs. lückenlos aufführen. Quellen: Strafprotokolle StAH 3; Nachlassinventare StAH 4a; Registraturprotokoll StAH 12/1 1602 Hans Khelbl (auch für 1603 und 1607 belegt) 1611-1636 David Schaibinger 1636-1641 Görg Khölbl († Juli 1641) 1641-1647 Michael Schaibinger (die Witwe übergibt 1650) 1648-1649 Mathias Rendax 1649-1657 Hans Mack 1658-1667 Hans Augustin/Nikolaus Griebl, dann Hans Maurer (Schuhmacher) 1667-1676 Bartlmä Kaiser/Hans Maurer († April 1676) 1676-1683 Hans Augustin/Niclas Griebl (Leinweber) Nach dem Tod von Hans Augustin (April 1683) werden die Hinterlassenschaftsinventare vorübergehend jeweils von einem Ratsgeschworenen als „Vice Richter“ aufgenommen. Ab Februar 1684 hatte Johann Augustin das Amt des Marktrichters inne. 1684-1693 Johann Augustin/Nicolaus Griebl 1693-1703 Petrus Ertl/Nikolaus Griebl 1703-1710 Hans Augustin/Nikolaus Griebl 1710-1714 Andre Ertl/Nikolaus Griebl 1715-1721 Johannes Gottinger/Petrus Kaiser (Leinweber) 1721-1723 Andreas Ertl/Petrus Kaiser 1723-1726 Johannes Baumgartner/Petrus Kaiser 1726-1729 Georg Friedl/Thomas Fesl (Leinweber) 1729-1739 Egidy Lang/Thomas Fesl 1739-1745 Johann Gottinger/Thomas Fesl, dann Johann Griebl (Leinweber) 1745-1749 Egidy Lang/Johann Griebl 1749-1755 Johann Gottinger/Johann Griebl 1755-1769 Johann Gottinger der Jüngere/Johann Griebl 1769-1781 Andreas Lang/Johann Griebl, dann Georg Kaiser (Leinweber) 1781-1789 Franz Gottinger/Georg Kaiser 1789-1796 Georg Kaiser/Andre Liebl (Leinweber) 1796-1801 Hans Wolf Ertl/Andre Liebl 1801-1805 Mathias Ertl/Andre Liebl Am 10. Mai 1805 legt Mathias Ertl sein Amt als Marktrichter nieder, der vorherige Marktschreiber Andreas Liebl wird zum Nachfolger ernannt. Ratsbürger sind: Ignatz Bauer, Georg Wundsam, Simon Zimmermann, Andreas Schreiner. Im Namen der ganzen Bürgerschaft unterzeichnet Josef Griebl. 2. Die MarktvorsteherMit der Abtretung des nordöstlichen Teils des ehemaligen Hochstifts Passau an Bayern (1805) wechselt der Amtstitel zum Marktvorsteher mit geändertem Zuständigkeitsbereich. 1805-1808 Andreas Liebl 1807-1824 Mathias Ertl Marktvorsteher/ab 1818 mit dem Amtstitel Bürgermeister 3. Die Bürgermeister:Ab 1818 übernehmen Bürgermeister, Marktrat und die Gemeindebevollmächtigten die Verwaltungsangelegenheiten.
Textbeitrag: Emmi Federhofer
[1] Ein Freiheitsbrief hatte Gültigkeit für die Regierungszeit des jeweiligen Fürstbischofs. Vom Nachfolger wurde er jeweils konfirmiert. |
 |
|
|
Die Marktverwaltung hatte nicht nur "innere Angelegenheiten" zu meistern. Als Anfang des 17. Jhs. das von Fürstbischof Leopold V. ausgehobene Söldnerheer in Richtung Böhmen marschierte, zogen plündernde Truppenteile auch durch Hauzenberg. Was die Bürgerschaft und die Bewohner der umliegenden Orte beim Durchzug des "Passauer Kriegsvolks" an materiellen und körperlichen Schäden zu erleiden hatten, hat Josef Wegertseder für die "Hauzenberger Rundschau" in den 1930iger Jahren zusammengestellt.
|
|
|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Einwohner des Marktes Hauzenberg anno 1603 und ihre Drangsale anno 1610 durch das „Passauer Kriegsvolk“„Der Lauf des teutschen Kriegsvolkes, das seine Musterplätze im Stift Passau zu suchen hatt’, hat am 26. August 1603 seinen Anfang genommen“. So beginnt ein Passauer Einlosierungsbericht über die Truppenmusterung und Anwerbung im Land der Abtei für die Zeit vom 28. August bis 16. September 1603, wobei im ganzen 10 Fähnlein Fußvolk und Reiterei unter der Führung des Obristen von Gaisberg zusammengestellt wurden zum Abmarsch nach Ungarn. Domprobst und Stiftsadministrator Christ. Pöttinger ward mit der schwierigen Aufgabe der Verproviantierung dieser 10 „Fähndl“ betraut. Von den Richtern und Amtleuten der Märkte hatte er zu diesem Zwecke rechtzeitig Berichte über Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten eingefordert, die allerorten, besonders aber aus Wegscheid, Waldkirchen und vor allem Hauzenberg, nicht recht günstig lauteten. Schließlich bekamen Passau, Innstadt und Ilzstadt 3 Fähnl, Obernzell und Untergriesbach ebenfalls 3, Wegscheid 2 und Waldkirchen 2 - Hauzenberg wurde verschont. Unterm 25. August 1603 hatte zwar der Landrichter der Abtei Friedrich Eckher zu Käpfing, kurf. Rat und Kammerer auch zu Hauzenberg Häuser und Untertanen beschreiben und abzählen lassen, aber im übrigen angefügt: „Mehrer Personen könnten zu Hauzenberg in Bedacht es eine lautere Armutei, respective einem jeden mehr gar nit als 3 Landsknecht einfuriert werden können, nit untergebracht werden. Die bestimmte Anzahl landsknecht einfach hinauslegen ist bei mir nit ratsam. Denn in diesem Fall ist der Zugang an allerlei Viktualien, an Fleisch und anderem, abgespeert und verhindert. Die sonstige Beschwerung gibt man E. Gn. ohne Maßgebung zu erwägen. Zudem ist gemeiner Markt zu Hauzenberg mit Bettgewand gar übel versehen, also daß ein Bürger vom andern in schlechten fürfallenden Nöten dasselbe aufnehmen muß.“ Das Eckher’sche Verzeichnis der Häuser des Marktes Hauzenberg vom 25. August 1603 soll in dem Originaltext folgen, weil es wohl eine sehr wichtige Quelle für die Beurteilung der Bevölkerungsbewegung in Hauzenberg darstellen dürfte; die beigegebenen Zahlen bezeichnen die Höchstziffer einzulosierenden Soldaten:
"Summe der Häuser zu Hauzenberg: 49; höchstens könnten auf diese Häuser 145 Personen einlogiert werden.“ 8 Jahre später, vom 12. März bis 21. Dezember 1610 wurde aber Markt und Amt Hauzenberg dafür umso schlimmer von der Soldateska heimgesucht und gequält. Wiederum hat der Landrichter Egkher unter Beiziehung ganz unparteiischer Leut (Hans Schaller, Hofinstrumentist und Türmer am Oberhaus und Carl Sauspacher, Hofwirt) ein Verzeichnis angelegt (HStU. Mu. Hochst. Lit. Passau 682 III). Diesmal war es eine Schadenschätzung: „Was die gehorsamsten armen Untertanen von dem zu Roß wie Fuß alldahin einlosierten Kriegsvolk samt dem nachfolgenden überhäuftem Troß spentiert und erlitten haben, da zu dieser Zeit Kaiser Rudolph Einlosier und Quartierung vorgenommen.“ Raub, Brunst, Verheerung und schweren Sachschaden ließ das um Weihnachten 1611 abziehende Kriegsvolk in Hauzenberg zurück. Dazumal war David Schaibinger Marktrichter gewesen, Paul Seidl, Jörg Hoblasberger und Paul Puffer Schmiede, Wolf Rühmannsdorfer Hufschmied und Weinschenk, Georg. Knödlseder Wein- und Bierwirt, Stefan Wagner, Bäcker, Georg Steyerer, Bader, Ulrich Frey, Wagner und Georg Augustin, Metzger. Matheus Lang, Wein- und Bierwirt hatte einen Sachschaden von 155 Gulden. Dem Jörg Polster hieben die mutwilligen Knechte alle Fenster ein. Dem Michl Weidinger haben die Reiter Haus, Hof, Fahrnis, Vieh und alles andere durch Prunst verdorben, dabei auch des Bindermeisters Hans Khärndtners Stadel verbrunnen. Ambrosi Till, ein Reiter, hat des Seidls Hausfrau so geschlagen, daß sie 9 Wochen lang kuriert werden mußte und Arztlohn und Pflege über 31 Gulden erforderten. Beim Abzug haben sie Christof Ecker mit Gewalt 3 Gulden herausgepreßt, dem Deidl das Bettgewand ausgeleert, beim Friedl und Paumgartner Hans die Fenster eingeschlagen. Das Handwerkszeug wurde dem Steinhauer Veit Eckmüller gestohlen: Eisenschlegel, Steinheber u.a.m. Benina Kölblin, die inzwischen verwittibte Marktrichterin beklagte den Verlust von zwei Ochsenhäuten. Dem Krinninger Steffl und Hoblasperger Jörg haben die Wüteriche die besten Roß aus dem Stall weggeritten. Hammerschmied Puffer fand sein Holzkohlenlager von den Reitern verderbt. Valentin Mackh, Schreiner zu Hauzenberg ist vom Militär gezwungen worden, Reistruhen, Zeltstangen, Büchsenschiffe, Tische und Stühle zu fertigen ohne Entgelt. Sigmund Mitterbauer, der Schuster, hat sämtlichen Befehlsleuten, wie Rittmeister Scherbadier und vielen anderen Mitreitern „aus angelegtem Gewalt“ Stiefel und Schuh machen und borgen müßen im Gesamtbetrag von 102 Gulden. Von vielen kleineren Diebereien zu schweigen – Messingmörser, Bestecke, Wertsachen wurden mitgenommen – zählt die brutale Zerstörung von Werkstatteinrichtungen zu den größten Roheiten: Andrä Kaiser, ein fleißiger Hauzenberger Webermeister, haben die Reiter die sämtlichen Webstühl verbrannt. Georg Paumbgartner vollends ist gleich zu Ankunft des Kriegsvolkes solchermassen geschlagen worden, daß er seiner Nahrung nit mehr hat nachkommen können, dahero man dann weiter von ihm nichts mehr begehrt; er vermeinte bei der Schadensaufnahme, daß man ihm seiner erlittenen Schmerzen halber mit einer Geldvergütung „leidentlich begegne“. Mathias Weyrpöck, Schulmeister wurde nächtlicherweil von den Begleitern des Rittmeisters Scherbardier geplündert: sie sind in sein Haus mit Gewalt eingebrochen und haben sein und seines Weibes „Leinngewand, Hemeter, Tisch- und Handtücher, Leilach und Bettziechen“ so tags zuvor gewaschen und auf die „Tüllen“ gehängt worden, mitgenommen. Die Marktgemeinde hatte am 12. März 1610 gleich nach eintreffen des kaiserlichen Kriegsvolkes den einlosierenden Reitern „allerlei Fastenspeis“ kaufen müssen um 40 Gulden. Dann verlangte Rittmeister Scherbadier 2 Stiere, 4 Ochsenhäut, 15 Eimer Wein für die ganze Reiterei, Eier und Schmalz; dem Fußvolk mußten die Hauzenberger ins Lager einen fetten Mastochsen liefern, sodaß sich die Schadenersatzansprüche der Gemeinde auf über 252 Gulden. Der Gesamtschaden Hauzenbergs wurde vom Landrichter auf nahezu 2100 Gulden veranschlagt. Bei dem Bauern des Amtes Hauzenberg hat das Kriegsvolk noch brutaler gehaust und große Wirtschaftswerte vernichtet. Ich greife nur eine Familie heraus, die Anetzberger, die sich seit dem 12. Jahrhundert von ihrem Stamsitz Arnoldsperge aus besonders über das Amt Hauzenberg verzweigt und besonders in Germannsdorf, Kollersberg, Jahrdorf, Kropfmühl, Knittlmühl, Hunaberg, Kelchham, Wehrberg usw. Wurzeln geschlagen haben. So hat Georg Arnetzperger auf dem passauischen Urbarhof Arnetzperg (heute Anetzberg westl. Oberkümmering) dem Rittmeister 20 Wochen lang Bier, Wein, Brot, Fleisch, Gewürz, 69 Maß Habern und 5 Fuder Heu beschaffen müssen, dem Fußvolk aber Kälber und einen Ochsen im Gesamtwert von 133 Gulden - heute ein kleines Gutsvermögen. Zum „Dank und Lohn“ für diese Spenden haben sie ihm beim Abzug 1 Roß entritten, 1 Öchsel mitgenommen, 3 Schwein und eine Anzahl Gänse und Hennen gestohlen, sodaß er einen Sachschaden bei 200 Goldgulden erlitt. Georg Arnetzperger von Kelchham hat den Rittmeister Ginzgo Frühjahr und Sommer 1610 fünfzehn Wochen lang beliefern, außerdem die Rittmeister Gall und Seidl gegen Donauwetzdorf vier Wochen lang tagtäglich mit Bier und Wein versehen müssen. Das herumstrolchende „gartende“ Fußvolk beschwichtigte er mit 6 Gulden. Beim Aufbruch auf St. Thomä vor Weihnacht haben sie ihm dafür geraubt: 1/2 Ztr. Flachs, Hacken und Beile, Ketten und Kolben, 6 Gäns, 1 Lamm und 1 Roß. Gesamtverlußt: 118 fl 2 ss 24 dl. Die drei Bauern von Werchperg (Wehrberg bei Krinning), Christoph Pentz, Hans Khinedödter und Steffl Arnetzperger haben den Rittmeister Feldscherer verköstigen und bedienen müssen und das Fußvolk das haufenweise herumstreifte – 22 Wochen lang. Haben dem Steffl die strolchenden Fußknechte nächtlicherweil drei der besten Rinder hinweggeführt und seinem Weib und Töchter zwei Mäntel gestohlen. Thoman Arnetzperger, Bauer zu Kollersberg, gab einem Reiter, namens Khlockmann für Gewürz und Bier 5 Gulden und einem Liutenant unter der grünen Liberey“ mit 7 Rossen auf 12 Wochen Verpflegung für 112 Gulden. Das Fußvolk, dem er 8 Gulden spendiert hatte, raubte aus seinen Ställen beim Abzug: 2 Stier, 1 Stutroß, 6 Lämmer und Baumannsfahrnis. Besonders zeichneten sich dabei aus die Landsknechte des Grafen von Suly. Der Schaden überstieg 172 Gulden.
Josef Wegertseder, Originaltext aus der "Hauzenberger Rundschau" 1930. Digital erfasst von Heinz Putzer. Abgekürzte Vornamen wurden nächträglich ausgeschrieben. Worterklärungen: Fähndl: Einheit von 300 Soldaten, Kompanie Fahrnis: Hab und Gut, Mobilien Tüllen: Diele, Raum unter dem Dach eines Hauses, Dachboden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
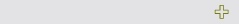


 Urkunde:
Urkunde: 


 ,
,







