 |
|
|
Die Kirchengeschichte von Oberdiendorf kann man nicht nur auf den Bau der Sankt Simonkirche oder etwa auf die Errichtung der Schulkapelle zwischen Oberdiendorf und Redling oder den Bau der kleinen Kapelle im Ort selbst beschränken. Sie ist vielmehr Teil der Kirchengeschichte des Südlichen Vorwaldes, insbesondere, der "Urpfarrei Kellberg". (Foto: H. Scherz)
|
|
|
|
 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
I. Oberdiendorf als Teil der Urpfarrei KellbergAls nach der Nordwaldschenkung im Jahre 1010 durch Kaiser Heinrich II. an das Nonnenkloster Niedernburg verstärkt Siedler in den Nordwald zogen, um die bereits vorhandenen Siedlungsräume zu vergrößern, haben sie sicherlich in Kellberg schon ein kleines Kirchlein aus Holz – vor der Zeit von Bischof Altmann (1065–1091) waren alle Gotteshäuser aus Holz – vorgefunden, von dem mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden kann, dass es von Esternberg aus betreut worden ist. Als Argument für diese Behauptung sei angeführt, dass die Kirche zu Untergriesbach (Griesbach am hohen Markte) im Jahre 1223 ebenfalls als Filialkirche von Esternberg genannt wurde. Ob nun Kellberg im Jahre 1076 oder 34 Jahre später (1110) Pfarrei wurde, oder als solche Erwähnung fand, ist für unsere Betrachtungen sekundär. (Veit 1965, 7 ff.) Fast 700 Jahre lang war Oberdiendorf Teil der Pfarrei Kellberg, die ursprünglich den Raum zwischen dem Satzbach im Westen, der Erlau und dem Aubach im Osten, sowie der Bergkette Steinberg – Oberfrauenwald – Geiersberg im Norden umfasste und sich später bis Oberneureuth gegen Sonnen hin ausdehnte.
In der Kaindlmühle bildeten eine Furt und ein Steg den Übergang über die Erlau. Von dort ging es den steilen Weg bergauf nach Zwölfling und dann in gerader Richtung zur Pfarrkirche nach Kellberg. Für die Kirchgänger aus den Orten Inneröd, Niederkümmering, Perling und Oberdiendorf führte der Weg – nach dem Überqueren der Erlau bei Lieblmühle – nach Panholz und Hundsdorf, dann über Raßbach weiter zur Kirche nach Kellberg. Unsere Vorfahren mussten also große Strapazen auf sich nehmen, um dem sonntäglichen Gottesdienst in ihrer Pfarrkirche beiwohnen zu können. Die Weiträumigkeit dieser „Urpfarrei Kellberg“ und die stark zunehmende Siedlungstätigkeit ab dem 11. Jh. machten deshalb schon sehr bald die Errichtung von Filialkirchen notwendig. Sie entstanden zunächst als so genannte Taufkirchen. Bis in die Mitte des 20. Jhs. war es nämlich üblich, die Neugeborenen entweder noch am selben Tag, spätestens aber am nächsten Tag taufen zu lassen. Vor allem zur Winterszeit hätten von den Neugeborenen viele den beschwerlichen Weg nach Kellberg nicht überlebt.
Abspaltung des Hauzenberger Pfarrgebietes Auch die Kirche von Hauzenberg war zunächst Filialkirche von Kellberg. Um 1342 wird sie erstmals als solche erwähnt.[1]
Anfänglich wollte man der Sage nach die neue Kirche nicht mehr in Kellberg, sondern weiter nördlich, in Oberdiendorf bauen. Die Zimmerleute hatten schon mit dem Behauen der Balken begonnen. Sie kamen dabei nicht recht voran, weil sie sich immer wieder in die Hände hackten. Ein Vogel nahm mit dem Schnabel einen blutigen Span und flog damit nach Kellberg, wo er ihn fallen lies. Daraufhin baute man dort die Kirche. Soweit die Sage: Oberdiendorf blieb damals weiterhin Teil der Pfarrei Kellberg und auch in die neu gebaute Kellberger Pfarrkirche brachten die Pfarrangehörigen aus dem Oberdiendorfer Raum noch etwa 300 Jahre lang Freud und Leid zum Herrgott.
Oberdiendorf wird Teil des neuen Pfarrsprengels Thyrnau Im 18. Jahrhundert hatte in Thyrnau die Wallfahrt zur schwarzen Lorettomadonna einen großen Zulauf erfahren. Deshalb ließ Fürstbischof Firmian in den Jahren 1765 - 69 dort eine Beichtkirche erbauen, die größtenteils aus dem Opferstock der Lorettokapelle finanziert worden war. Gut 20 Jahre später am 1. Juni 1785 erhob Fürstbischof Reichsgraf von Auersperg
Thyrnau zum Pfarrvikariat und abermals ein Jahr später, am 16. August 1786 schließlich zur Pfarrei. Die ursprüngliche Beichtkirche wurde zur Pfarrkirche erhoben. Allerdings war diese Kirche in Thyrnau damals noch deutlich kleiner als heute. [2] Zu diesem neuen Pfarrsprengel Thyrnau kamen nun auch Oberdiendorf und alle Orte der späteren Gemeinde Oberdiendorf. Ein leidiges Kapitel für Pfarrer und Pfarrvolk in Thyrnau war lange Zeit das Fehlen eines Glockenturms. Etwa 130 Jahre mussten sie sich mit einer kleinen Glocke im Türmchen der Pfarrkirche begnügen, was ihnen den Spott der Nachbarn aus Kellberg eintrug. Im Jahre 1894 aber ließ Pfarrer Josef Kapfhamer unter tätiger Mithilfe der Pfarrangehörigen einen Kirchenturm erbauen und 4 Glocken anschaffen. Sein Nachfolger Pfarrer Johann Lichtenegger ließ 1902/03 die Kirche verlängern und die zwei Nischen für die Seitenaltäre anbauen. Das heutige Aussehen der Kirche verdanken wir Pfarrer Josef Prager. Er ließ im Jahre 1928 den Altarraum, das Presbyterium, anbauen und den jetzigen Hochaltar errichten.
II. Der Bau der kleinen Dorfkapelle in OberdiendorfUm 1816 gab es eine katastrophale Missernte. Frühjahr und Sommer waren nass und verregnet und es war so kalt, dass auch in den Monaten Juni, Juli und August geheizt werden musste. Das Getreide, wenn es nicht schon auf dem Halm verfaulte, kam nicht zur Reife. In den Jahren 1817/18 grassierte zudem in Oberdiendorf und vermutlich auch in der In einem Schreiben des kgl. Landrichters Sigmund vom 9. August 1828 an den damaligen Ortspfarrer von Thyrnau, Johann Steininger hieß es, dass „die Gemeindeverwaltung zur Verantwortung vorgeladen“ werden wird. Es erschien der Gemeindevorsteher Jakob Stemplinger, Bauer zu Rödling, und bringt vor, „nicht die Gemeinde Oberdiendorf, sondern die Bewohner Oberdiendorfs erbauten diese Kapelle. Eine polizeiliche Bewilligung zu diesem Bau hatten die Bewohner Oberdiendorfs nicht, weil sie glaubten, zur Erbauung einer solchen Kapelle sei sie nicht nötig. Dieser Bau wurde ohne Beiziehung von Baumeistern errichtet. Da die Bewohner Oberdiendorfs aus Unwissenheit den polizeilichen Bau-Consens nicht erhielten, dieser Bau aber aus rein religiösem Sinne und in bester Absicht geschah, so bitte ich nachträglich die Genehmigung zu erteilen.“ „Pfarrer Plöd von Thyrnau weihte diese Kapelle in Oberdiendorf, ungefähr vier Wochen vor seiner Versetzung“, fügte der Gemeindevorsteher noch hinzu. Er musste seine Angaben noch unterzeichnen und wurde dann gnädig entlassen. (Pfarrarchiv Thyrnau)
Bereits im Vormonat, genau am 20. Juli 1828, hatte Pfarrer Steininger im Auftrag der Dorfbewohner von Oberdiendorf ein Schreiben an das kgl. Landgericht in Wegscheid, zwecks Aufklärung in Sachen „Dorfkapellenbau“, mit folgendem Inhalt verfasst: „Die Gemeindeverwaltung, eigentlich zwei Deputierte des Dorfes Oberdiendorf, stellen beim unterzeichneten Pfarramte die Bitte, man möchte dem kgl. Landgerichte über die von genannter Dorfgemeinde an der von Hauzenberg nach Thyrnau führenden Strasse erbaute Kapelle Aufschluss erteilen. Gemäss der an die Verwaltung ergangenen Weisung [… ] soll dieselbe binnen 8 Tagen die Baubewilligung vorweisen. Was die Baumeister betrifft, so können diese nicht namhaft gemacht werden, weil kein Baumeister, sondern nur die im Dorf befindlichen Maurer- und Zimmergesellen beigezogen wurden. Als Hilfe wurden noch einige Individuen aus der Dorfgemeinde zugezogen. Was den Ausweis über die Baubewilligung anbelangt, so hat die Dorfgemeinde hierüber nichts in Händen und auch aus wahren Unverstand keiner solchen Bewilligung nachgesucht. Diese Bauern waren in der guten Meinung, dass ihnen dieser Bau ohnedies erlaubt sei, weil sie sahen, dass auch an anderen Orten hie und da dergleichen Feldkapellen wieder errichtet wurden, ob mit oder ohne Bewilligung ist nicht bekannt. Übrigens ist diese Dorfkapelle keine kleine Kirche, wie fälschlich angezeigt wurde, ganz gemauert und verordnungsgemäss mit Dachziegeln eingedeckt, steht eine kleine Strecke außerhalb dem Dorf an der Strasse ohne jedoch derselben einen Nachteil zu bringen und dient den Dorfbewohnern an Sonn- und gebotenen Feiertagen, ihre nachmittägliche Andacht zu verrichten. Die Veranlassung zu diesem gemachten Versprechen, die im Dorfe grassierende Viehseuche, welches diese Leute bei ihrem religiösen Sinn nicht unerfüllt lassen zu dürfen glaubten. Folgt man diesen Ansichten und Aufschlüssen, kommt man zur Überzeugung, dass die Gemeinde Oberdiendorf bei der Erbauung dieser Kapelle nicht mit bösem Willen zu Werke ging. Es geschah größtenteils aus Unwissenheit, dass man sich beim Bau der Kapelle nicht an die allerhöchsten Vorschriften hielt. Dem kgl. Landgerichte auf das huldvollste. Mit ausgezeichneter Hochachtung des kgl. Landgerichts Gehorsames Pfarramt.“ (Pfarrarchiv Thyrnau)
Bezüglich der Kapelleneinweihung schrieb Pfarrer Steininger am 28. August 1828 an das Landgericht Wegscheid: „Über die Einweihung der Kapelle zu Oberdiendorf soll sich das unterzeichnete Pfarramt [ … ] äußern, ob nach der in Abschrift beigefügten Erklärung des Gemeinde-Vorstehers Jakob Stemplinger diese Einweihung richtig geschehen sei oder nicht und ob von Seiten der geistlichen Oberbehörde zu dieser Einweihung eine Bewilligung vorliegt oder nicht. Dass der vorige, nun nach Kötzting versetzte Pfarrer Plöd, noch bei seinem Hiersein die genannte Kapelle eingeweiht hat oder haben soll, ist dem Pfarrer in soweit bekannt hierüber hie und da in wenigen Äußerungen nur vom Segnen gesprochen wurde. Die Erlaubnis hierzu vom bischöflichen Ordinariat erbeten, ob er sie aber wirklich oder nur vorgeblich erhalten habe, hierüber liegt bei dem Pfarramte nicht das Mindeste vor. Mit ausgezeichneter Hochachtung des kgl. Landgerichts Gehorsames Pfarramt, Steininger, Pfarrer.“ (Pfarrarchiv Thyrnau)
Mit diesem Schreiben war der Papierkrieg um den Bau dieser kleinen Dorfkapelle endlich erledigt. Hundert Jahre waren zwischenzeitlich vergangen, in denen die kleine Kapelle viele Menschen kommen und gehen sah. Allerdings war das kleine Kirchlein nun nicht mehr besonders ansehnlich. Der Zahn der Zeit hatte erheblich an ihm genagt. Als im Jahre 1931 beim großen Brand im Dorf drei Anwesen: Andorfer (Bäcker), Fürst (Schmiedbauer) und Amsl (Wirt) nieder brannten, hatte man im Trubel des Geschehens sogar die Schweine in die Kapelle gesperrt. Zwei Jahre später versuchte der Gemeinderat von Oberdiendorf mit Hilfe des Bezirksamtes den Hühnerstall, der vom Gastwirt Amsl an die Kapelle angebaut worden war, zu entfernen, was deshalb misslang, weil es sich um einen genehmigungsfreien Anbau handelte.
III. Bau der Schulkapelle zwischen Oberdiendorf und RedlingAnlässlich einer kanonischen Visitation in der Pfarrei Thyrnau, bei der auch die Dorfkapellen besichtigt wurden, wurde dem damaligen Pfarrer Josef Prager angeraten, die alte Dorfkapelle in Oberdiendorf wegen ihres schlechten baulichen Zustandes abzureißen und dafür eine neue, etwas größere Kapelle zu erbauen, in der auch Schulgottesdienste abgehalten werden können. Dieser Vorschlag wurde ein Jahr später in die Tat umgesetzt. Von seinem Flurstück stiftete der „Höfenkrieg“ (Johann Ritzer), Bauer aus Oberdiendorf, den benötigten Baugrund (etwa 252 qm). Im Mai 1935 wurde mit dem Bau der Schulkapelle begonnen. Der Abriss der alten Dorfkapelle durch den Gastwirt Amsl dürfte zur gleichen Zeit erfolgt sein.[3] Der Baumeister Josef Irry aus Oberdiendorf wurde mit dem Bau der neuen Kapelle beauftragt. Pfarrer Prager schrieb dazu eine spärliche Notiz in die Kirchenchronik [4]: „Vom Mai bis Dezember 1935 wurde die Schulkirche in Oberdiendorf gebaut und eingerichtet.“ (Pfarrarchiv Thyrnau) Für Maurer-, Erd-, Zimmererarbeiten, Schreiner, Spengler, Architekt, Maler und Vergolder, Elektromeister, Baumaterial, Frachten, Gebühren, Darlehensrückzahlung und Verschiedenes waren Ausgaben in Höhe von 6218,26 RM entstanden. Finanziert wurde der Kirchenbau durch Einnahmen aus der Diözesankirchenstiftung, aus der Kirchensteuer, durch Spenden aus der Bevölkerung und nicht zuletzt durch eine Zuwendung von Pfarrer Josef Prager. (Pfarrarchiv Thyrnau).
Ferner vermerkte Pfarrer Prager: „Der Bauplatz wurde vom Bauern Johann Ritzer aus Oberdiendorf geschenkt, das Holz größtenteils von der Bauernschaft gespendet, welche auch freiwillig viel Hand- und Spandienst leistete. Sägewerksbesitzer Hermann Kandlbinder, Lieblmühle, leistete unentgeltlich den Holzschnitt. Die Brüder Schauer, Redling, lieferten unentgeltlich den Sand. Das Altarbild des hl. Josef ist eine Leihgabe des bischöflichen Ordinariats in Passau. Die Statuen der Madonna und der Apostel Andreas und Johannes schenkte Pfarrer Prager.“ (Pfarrchronik Thyrnau). Am 2. September 1935 wurde die Schulkapelle durch Generalvikar Franz Ser. Riemer feierlich geweiht. Auf dem kleinen Glockenturm der Schulkapelle könnte die Glocke aus der alten Dorfkapelle wiederverwendet worden sein. Andere Quellen jedoch berichten, dass sie der alte Kainz aus Oberdiendorf gestiftet habe. Die „Janasköchin“ Anna Hirsch übernahm auch in der neuen Kapelle das Läuten der Glocke beim Gebetläuten oder wenn eines Dorfbewohner gestorben war. Auch versah sie den Mesnerdienst. Als Anna Hirsch 1960 verstarb, übernahm ihre Nichte Therese Fürst, die Schmiedbäuerin, das Amt der Mesnerin. Die bereits nach zwei Jahren auftretenden Baumängel kommentierte Pfarrer Boxleitner in der Kirchenchronik wie folgt: „Die 1935 erbaute Schulkapelle in Oberdiendorf ist schon reparaturbedürftig. Der ganze hölzerne Boden der Kirche und der Sakristei ist vom Schwamm durchzogen und zerfressen. Der Bauunternehmer Irry von Oberdiendorf hat sich seinerzeit alle im Bauplan vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen gegen den Schwamm, wie Betonunterlage, Abdichtung usw. erspart und den Fußboden einfach in den Dreck hinein gelegt. Der Holzboden wurde durch ein Steinpflaster ersetzt. Das Podium für das Gestühl hohl gelegt und abgedichtet. Es stifteten zu den Kosten: Geistl. Rat Prager 200 DM und Pfarrer Boxleitner 50 DM, der Rest wurde von der Bevölkerung aus Oberdiendorf aufgebracht.“ (Pfarrchronik Thyrnau)
Erhebung der Oberdiendorfer Schulkapelle zur FilialkircheBischof Simon Konrad Landesdorfer errichtete mit Datum vom 26. Juli 1939 die Tochterkirchenstiftung Oberdiendorf. Er gab damit dem kleinen Kirchlein den Charakter einer Filialkirche. Auf Initiative des in Oberdiendorf äußerst beliebten Paters Norbert vom Kloster Thyrnau wurde eine Fatima-Muttergottesstatue gekauft und am 13. Mai 1956 von diesem feierlich geweiht. Seit geraumer Zeit war in der Bevölkerung von Oberdiendorf der Wunsch nach einem Sonntagsgottesdienst in der Schulkapelle laut geworden, doch Pfarrer Boxleitner widersetzte sich diesem Ansinnen. Auf sanften Druck seitens des Bischöflichen Ordinariats wurde ab dem 11. Oktober 1959 der Gottesdienst auch am Sonntag eingeführt. Am 6. März 1960 fand der Empfang von Pfarrer Valentin Horner, dem neuen Thyrnauer Pfarrer, vor der Schulkapelle statt. Er wurde von Bürgermeister Alois Fürst, den Vereinsvorständen, sowie der gesamten Bevölkerung herzlich begrüßt. Auch der neue Pfarrer führte die Sonntagsgottesdienste in der Schulkapelle weiterhin durch.
IV. Der Bau der neuen St. SimonkircheAufgrund reger Siedlungstätigkeit und vermehrten Zuzugs von Familien reichte bei den Sonntagsgottesdiensten der Platz nicht mehr aus. Die Kapelle hatte insgesamt nur 100 Sitzplätze. Nachdem aber bei einer Kirchenbesucherzählung 224 Gottesdienstbesucher gezählt wurden, beantragte man am 11. Oktober 1960 beim Bischöflichen Ordinariat eine Erweiterung der Schulkapelle. Nach wiederholter Anmahnung durch Pfarrer Horner kamen am 10. Januar 1962 Dr. Baumgärtler vom Bischöflichen Ordinariat und Diözesanbaumeister Hornsteiner in dieser Angelegenheit nach Oberdiendorf. Nach eingehender Beratung wurde ein Kirchenneubau empfohlen. Bereits eine Woche später, am 17. Januar 1962, wurde in einer Bürgerversammlung ein Kirchenbauverein gegründet und eine Vorstandschaft, bestehend aus Pfarrer Horner, Bürgermeister Fürst sowie Gemeinderat Höfler, gewählt. Heftig umstritten war zunächst die Standortfrage: Ein von Ludwig Schauer, Bauer in Redling, unweit der Schulkapelle auf der anderen Straßenseite, am Schulhausstraßl, kostenlos zur Verfügung gestelltes Baugrundstück [5] erwies sich wegen der Hanglage als ungeeignet. Zudem hätte ein hier befindliches Transformatorenhaus versetzt werden müssen. So fand in dieser Sache am 16. Februar 1962 in der Gemeindekanzlei in Oberdiendorf eine Besprechung statt, von der Hauptlehrer Josef Greschniok folgendes Protokoll verfasste. Erklärung: Zum Zwecke der Grundstücksbeschaffung für den Kirchenneubau in Oberdiendorf. Heute Freitag, den 16.02.1962, erschienen in der Gemeindekanzlei Oberdiendorf folgende Beteiligte: 1. die Eheleute Ludwig und Karoline Schauer, Redling 16 2. die Eheleute Josef und Therese Fürst, Oberdiendorf 12 3. Ludwig Höfler, Oberdiendorf 34 4. Johann Ameseder, Perling 20 5. Alois Schiermeier, Redling 15 6. Bürgermeister Alois Fürst, Niederkümmering 26 7. Pfarrer Valentin Horner, Thyrnau 8. als Schriftführer Hauptlehrer Josef Greschniok, Oberdiendorf (Pfarrchronik Thyrnau)
Der Kirchenneubau in Oberdiendorf wurde schließlich auf dem Grundstück der Eheleute Ludwig und Rosa Höfler (Oberdiendorf 34) geplant. Beide erklärten sich grundsätzlich bereit, das für den Kirchenneubau benötigte Grundstück abzutreten. Sie machten allerdings zur Bedingung, dass die Eheleute Josef und Therese Fürst (Oberdiendorf 12) von ihrem angrenzenden Flurstück die Hälfte des für den Kirchenbau benötigten Grundes an sie, (die Familie Höfler) abtreten. Der Bauplan konnte nun dem Bischöflichen Ordinariat zur Prüfung zugeleitet werden. Dieses erklärte am 10. April 1963 nach eingehender Prüfung, man sei mit dem Platz, auf dem die neue Kirche einmal stehen sollte, einverstanden. Bei der Ortsbesichtigung am 29. Juli 1963 wurde der vorgesehene und im Bebauungsplan eingezeichnete Bauplatz durch Prälat Baumgärtler aber wieder abgelehnt. Daraufhin hatte man in der "neuen Siedlung" einen aus vier Bauparzellen (ca. 3000 qm) bestehenden Bauplatz endgültig festgelegt, welcher so am 13. September 1963 vom Gemeinderat genehmigt wurde. An den Erschließungskosten, die von der Gemeinde gefordert werden mussten (Betrag: 14.900 DM), drohte das Vorhaben letztlich aber doch noch zu scheitern. Pfarrer Horner nämlich lehnte diese Zahlung kategorisch ab. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt wurde von Seiten der Gemeinde die Übernahme der Erschließungskosten zugesichert. Sie wurden im Jahre 1973 von der neuen Großgemeinde Hauzenberg übernommen. Noch vor der endgültigen Klärung der Bauplatzfrage, wurde Regierungsbaumeister Dipl. Ing. Architekt Beckers aus Regensburg mit der Planung des neuen Gotteshauses beauftragt. Ein am 31. Juli 1962 vorgestellter Planungsentwurf mit einem Kostenvoranschlag von ca. 375.000 DM (ohne Orgel, Glocken und Läutwerk und nur 300 Sitzplätzen) wurde fallen gelassen. Ein zweiter Entwurf der 400 Sitzplätze vorsah, wurde zum Vorentwurf ausgearbeitet. Die geplante Rundkirche sollte ein zeitgemäßes, modernes Bauwerk werden. Mit der Genehmigung durch die Gemeinde, das Landratsamt und das Bischöfliche Ordinariat, konnte der Vorentwurf an die Regierung und die Oberste Baubehörde weitergeleitet werden.
Am 12. Juli 1964 nahm Domdekan Prälat Dr. Johann Baumgärtler die feierliche Grundsteinlegung vor. Bevor die Grundsteinlegungsurkunde in eine Kupferkartusche gelegt und eingemauert wurde, verlas Pfarrer Horner deren Wortlaut. Mit der Urkunde wurde auch je ein Exemplar der Passauer Neuen Presse, des Bistumsblattes, der Katholischen Frau und der Zeitschrift „Mann in der Zeit“ sowie Geldmünzen und ein Vereinszeichen des Veteranenvereins Oberdiendorf im Grundstein eingemauert.
Der Richtspruch:
Im Gasthaus „Zum Stern“ wurde die Grundsteinlegung schließlich gebührend gefeiert. Neben Domdekan Baumgärtler, Bürgermeister Fürst und der Kirchenverwaltung, fanden sich alle bisher am Bau beteiligten Arbeiter ein, denen Pfarrer Horner herzliche Worte des Dankes sagte. Er ließ das bisherige Bemühen und Arbeiten Revue passieren und meinte in launischer Rede, dass beim Bauplatz erst das fünfte Grundstück (es wurden noch weitere Plätze geprüft), nämlich das von Franz Andorfer im neuen Baugebiet, das passende war. Dieses allerdings sei auch das schönste. Während die Bauarbeiten gut voranschritten, wurden am 25. Juni 1965 in der Glockengießerei Perner in Passau-Hacklberg die vier Glocken für die neue Kirche gegossen.
Vor Beginn der Weihehandlung stellte Pfarrer Horner den Oberdiendorfern die neuen Glocken vor Die größte Glocke, 14 Ztr. schwer, ist der heiligen Familie geweiht und trägt den Spruch: „Jesus, Maria helft unseren Familien“. Die zweite Glocke, 10 Ztr. schwer, mit dem Bild der Gottesmutter. Sie führt den Spruch: „Maria, Königin des Friedens, bitte für uns“. Die dritte Glocke wiegt 6 Ztr. und ist dem heiligen Florian geweiht. Bei ihr lautet der Spruch: „Beschütze Haus und Hof und unseren Glauben“. Die kleinste Glocke mit einem Gewicht von 3 Ztr. ziert das Bild des heiligen Schutzengel darunter der Spruch: „Heiliger Schutzengel geleite uns zum seligen Ende“. Beim Einholen der Glocken gaben die Ehefrauen der jeweiligen Bauern mit zwei weißgekleideten Mädchen den Glocken das Ehrengeleit. Ein denkwürdiger Tag in der Geschichte von Oberdiendorf.
Weihe der neuen St. SimonkircheNach einer Bauzeit von 19 Monaten war es so weit: Oberdiendorf konnte zum größten Fest in der Geschichte des Ortes rüsten – zur Weihe der neuen Kirche. Umfangreiche Vorbereitungen waren getroffen worden, um diesen großen Tag würdig und angemessen begehen zu können. Neben den vielen Menschen aus Oberdiendorf und der näheren Umgebung, konnten eine Reihe von Ehrengästen willkommen geheißen werden. Unter ihnen der Bundestagsabgeordnete Franz X. Unertl, die Landtagsabgeordneten Hermann Wösner und Anton Hochleitner, Landrat Fritz Gerstl, Regierungsrat Dr. Josef Gmelch, der Architekt Dipl. Ing. Hans Beckers, sowie Bürgermeister Alois Fürst mit den Gemeinderäten. Von den geistlichen Würdenträgern waren anwesend: Bischof Koadjutor Dr. Antonius Hofmann in Vertretung des Diözesanbischofs Simon Konrad Landesdorfer, der beim Konzil in Rom weilte, sowie Domdekan Prälat Dr. Johann Baumgärtler mit einer Reihe weiterer Priester. Trotz des unwirtlichen Wetters an diesem 21. November 1965 (es regnete in Strömen) formierte sich vor der alten Schulkapelle ein langer Festzug, der zugleich auch ein Abschied vom „Schulkirchlein“ war. Auf dem Weg zur neuen Kirche hielt der Zug beim Haus von Fritz Ilg, wo Bischof Koadjutor Antonius Hofmann abgeholt wurde. Neben Bürgermeister Fürst, der den hohen Gast im Namen der Gemeinde begrüßte, entboten die Schülerinnen Monika Weißhäupl und Margit Weidinger Willkommensgrüße in Gedichtform. Durch ein langes Spalier der Vereine schritt der Bischofs Koadjutor mit der Geistlichkeit zur neuen Kirche. Nun begann die feierliche Konsekration des neuen Gotteshauses. Die Weihehandlung vollzog sich in drei Abschnitten:
Auch in der neuen Kirche versah Frau Therese Fürst, die Schmiedbäuerin, mit Eifer und Gewissenhaftigkeit das Amt der Mesnerin, bis sie es 1977 in jüngere Hände legte. Seit dieser Zeit versieht nun Franziska Schätzl dieses Amt, zu dem im Laufe der Jahre noch viele Aufgaben hinzu kamen. Umpfarrung Oberdiendorfs nach HauzenbergAls im Zuge der Gebietsreform die Gemeinde Oberdiendorf 1972 aufgelöst und in die Großgemeinde Hauzenberg eingemeindet wurde, plante man, Oberdiendorf in Zukunft auch im kirchlichen Bereich von Hauzenberg aus zu betreuen. Noch bevor die Eingemeindung Oberdiendorfs nach Hauzenberg vollzogen war, begann man seitens des Bischöflichen Ordinariats mit der schrittweisen Ausgliederung Oberdiendorfs aus der Pfarrei Thyrnau. Ab dem Schuljahr 1971/72 wurde der Religionsunterricht an der Schule in Oberdiendorf von Hauzenberg aus erteilt. Zum 1. Januar 1973 war die Abtrennung gänzlich vollzogen. Pfarrer Valentin Horner schrieb dazu im Chronikbuch der Pfarrei Thyrnau: „Am Sonntag den 31. Dezember 1972 hielt Pfarrer Horner den letzten Gottesdienst in Oberdiendorf. Er sprach einige Dankesworte. Abschied gab es keinen. Eine kleine Schar war nach dem Gottesdienst in die Sakristei gekommen und dankte dem Pfarrer und überreichten ein kleines Geschenk. Ab 1. Januar 1973 übernimmt die Pfarrei Hauzenberg die seelsorgliche Betreuung von Oberdiendorf.“ (Pfarrchronik Thyrnau) Seither sind fast 40 Jahre vergangen, da nun Oberdiendorf Teil der Pfarrei Hauzenberg ist. Obwohl Oberdiendorf von Kellberg nach Thyrnau und von dort nach Hauzenberg kam, ist Oberdiendorf doch dort geblieben, wo es immer war, in der ehemaligen Urpfarrei Kellberg.
Literatur und Quellen:
Arbeitskreis Dorfgeschichte Oberdiendorf Textbeitrag: Franz Mautner
[1] HStA, Hochstift Passau Lit. 1575/1 fol. 5 [2] Sie reichte in der Länge etwa bis zum heutigen Predigtstuhl der Kirche. [3] Eintragungen in den Kirchenrechnungen vom 14.07.1935 belegen eine Zahlung von 15 Mark für ein Mauerstück und etwas später eine Zahlung von 20 Mark für das restliche Abbruchmaterial. [4] Es war schon NS-Zeit [5] 850 qm des Flurstücks Pl. Nr. 771 |
||||||||||||||||
 |
|
|
Nach nur einjähriger Bauzeit fand im Jahr 1962 die feierliche Einweihung der Schulkirche in Krinning statt.
(Foto: Emmi Federhofer)
|
|
|
|
 |
|
Nach nur einjähriger Bauzeit fand im Jahr 1962 die feierliche Einweihung der Schulkirche in Krinning statt.
(Foto: Emmi Federhofer)
|
 |
|
|
Unter tatkräftiger und unentgeltlicher Mithilfe der Bewohner der ehemaligen Gemeinde Raßberg wurde 1938 die Kirche "Zum Guten Hirten" in Wolkar fertig gestellt. Von Anfang an fand regelmäßig Sonntagsgottesdienst, an Wochentagen Schulgottesdienst statt. 1941 erhielt die Filialkirche in Kooperator Adam Gensheimer erstmals einen Kirchenvorstand. (Foto: pfarrei-hauzenberg.de)
|
|
|
|
 |
|
Planung und Bau der SchulkapelleSeit 1931 durfte mit oberhirtlicher Genehmigung im Schulsaal von Germannsdorf einmal wöchentlich eine hl. Messe zelebriert werden. Die Wolkarer wollten vor Germannsdorf nicht zurückstehen und sie ruhten nicht, bis auch bei ihnen im Schulsaal Gottesdienst gefeiert werden durfte. Wenige Jahre später gab die regelmäßige „Versammlung zum gemeinsamen Gebet“ den Anlass für die Planung einer Schulkirche. Von der nationalsozialistischen Regierung wurden bald hygienische Gründe gegen die Abhaltung der heiligen Messe in Schulzimmern ins Feld geführt – kurzum, die Gemeinschaft der Gläubigen war in den Schulsälen nicht geduldet. Um nun endlich einen kircheneigenen Raum zu schaffen, wurde der Bau einer Schulkirche beantragt und 1937 vom bischöflichen Ordinariat in Passau genehmigt. Zur Finanzierung des Bauvorhabens hatte der Generalvikar Dr. Riemer von Seiten der Diözese eine finanzielle Unterstützung von 1000 RM in Aussicht gestellt. Das Pfarramt in Hauzenberg sollte den Betrag von 4000 RM an Eigenmitteln aufbringen. Die Bevölkerung zeigte erfreulichen Opfersinn. Eine Sammlung erbrachte den Betrag von 2500 RM und die Wintermonate wurden eifrig zur Anlieferung von unentgeltlichem Baumaterial genützt. Schon im April 1938 stand der Rohbau der Schulkapelle. Die vorhandenen Barmittel und 800 RM in Ware (Holz, Stein) waren allerdings aufgebraucht. Erneut musste um einen Bauzuschuss im bischöflichen Ordinariat nachgesucht werden. Es war Franz Seraphin Niederhofer, Pfarrer in Hauzenberg (1929-1943), der als Bauherr das Projekt betreute und in unermüdlichem Einsatz das Bauvorhaben schließlich zu einem erfolgreichen Abschluss brachte.
Geboren am 2. Februar 1881 in Holzkirchen Am 29. Juni 1907 in Passau zum Priester geweiht Bis 30. April 1909 Verweser der Pfarrei Thurmannsbang Von 1909 bis 1911 Seminarpräfekt in Passau Von 1911 bis 1918 Kooperator in Passau-Innstadt Am 11. Januar 1921 zum Pfarrer von Wildenranna ernannt Seit 2. April 1929 Pfarrer von Hauzenberg Am 1. September 1943 zum Dekan für Obernzell bestellt. Am 6. Dezember 1938 konnte die Schulkapelle „Zum guten Hirten“ durch den hochwürdigen Prälaten, Dompropst Dr. Riemer geweiht werden. Seit 30. 12. 1938 war auch der sonntägliche Gottesdienst genehmigt. Die Gläubigen der Umgebung kamen an den Sonntagnachmittagen zum Rosenkranzgebet und in der Fastenzeit zur Kreuzwegandacht zusammen. Damit diese auch die Ablässe gewinnen können, war ein einfacher Kreuzweg mit Stationskreuzchen nach feierlicher Weihe angebracht worden.1 Im selben Jahr 1939 nahm Pfarrer Niederhofer die Benediktion der kleinen, gerade einen Zentner schweren, Glocke vor. Im April 1940 vermerkte er in der Pfarrchronik: „Die Kirchenglocken müssen für den unseligen Krieg gemeldet werden. Hauzenberg hat Klangstahlglocken, die werden verschont bleiben. Aber das Glöcklein in Wolkar, das am 06.03.1939 erworben und benediziert wurde, ist gefährdet.“ In der Filialkirche Wolkar, Pfarrei Hauzenberg, fand regelmäßig Sonntagsgottesdienst statt und an Wochentagen wurde Schulgottesdienst gehalten. Im Jahre 1941 wurde Kooperator Adam Gensheimer zum Rector ecclesiae, mit den Vollmachten eines Kirchenvorstandes ernannt. Am 29. Dezember 1941 wurden die Befürchtungen von Pfarrer Niederhofer wahr. Er vermerkt in der Pfarrchronik: „Die Glocke in der Schulkapelle Wolkar wurde heute zur Ablieferung abmontiert. Es steht offenbar gut ums Vaterland und den Krieg!“
Für den 2. Februar 1953 ist die „Errichtung der Nebenkirchenstiftung Wolkar“ geplant. Im Jahr 1956 wird der bis dahin übliche Bittgang von Hauzenberg nach Kellberg abgeändert und dafür nach Wolkar gegangen - der Fußmarsch verkürzt sich so auf eine Stunde. Eine weitere Aufwertung für die Filialkirche in Wolkar.
Textbeitrag: Emmi Federhofer
Quellen: Chronik der Pfarrei Hauzenberg (Regestenbuch) 1908-1959 ABP OA Pfa Hauzenberg II, 5d
[1] Dieser fand in der Franziskus- bzw. Pfarrhofkapelle in Hauzenberg Verwendung, als im Jahr 1942 für Wolkar ein neuer Kreuzweg (vom Institut B.M.V in Osterhofen) angeschafft wurde. Umbaumaßnahmen in den nachfolgenden Jahren(Textbeitrag in Bearbeitung)
|
|
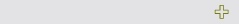

 Da die Pfarrkirche am südlichen Ende dieses großräumigen Pfarrgebiets zur Donau hin lag, waren weite Wege zur Kirche unvermeidlich. Auch der Kirchweg von Oberdiendorf und Redling nach Kellberg war lang und beschwerlich. Er führte nach Süden, in den Talgrund der Erlau. Noch heute kennt man die Flurnamen, die auf diesen Weg hinweisen: „Kirchensteigäcker“ (um 1827) und „Kirchensteigfeld“ (1985).
Da die Pfarrkirche am südlichen Ende dieses großräumigen Pfarrgebiets zur Donau hin lag, waren weite Wege zur Kirche unvermeidlich. Auch der Kirchweg von Oberdiendorf und Redling nach Kellberg war lang und beschwerlich. Er führte nach Süden, in den Talgrund der Erlau. Noch heute kennt man die Flurnamen, die auf diesen Weg hinweisen: „Kirchensteigäcker“ (um 1827) und „Kirchensteigfeld“ (1985).  Obwohl mit der Erhebung Hauzenbergs zur Pfarrei im Verlauf des 14. Jhs. ein großer Teil des ursprünglichen Pfarrgebietes selbstständig wurde, erfolgte in Kellberg zwischen 1473 und 1493 der Bau der heutigen, spätgotischen Kellberger Kirche. Wie in vielen Orten rankt sich auch um diesen Kirchenneubau in Kellberg eine Sage:
Obwohl mit der Erhebung Hauzenbergs zur Pfarrei im Verlauf des 14. Jhs. ein großer Teil des ursprünglichen Pfarrgebietes selbstständig wurde, erfolgte in Kellberg zwischen 1473 und 1493 der Bau der heutigen, spätgotischen Kellberger Kirche. Wie in vielen Orten rankt sich auch um diesen Kirchenneubau in Kellberg eine Sage:
 Umgebung eine verheerende Viehseuche. Nach diesen harten, schicksalsreichen Jahren gelobten die Bewohner von Oberdiendorf eine Kapelle zu bauen. Im ersten Halbjahr des Jahres 1828 wurde das Versprechen eingelöst und an der damaligen Strasse von Hauzenberg nach Thyrnau, unweit des Wirtshauses (heute Gasthaus „Zum Stern“), eine kleine Dorfkapelle errichtet. Man baute in „Eigenregie“, wie man heute sagen würde. Dies missfiel dem kgl. bayerischen Landgericht in Wegscheid, zu dem die junge Gemeinde Oberdiendorf damals gehörte.
Umgebung eine verheerende Viehseuche. Nach diesen harten, schicksalsreichen Jahren gelobten die Bewohner von Oberdiendorf eine Kapelle zu bauen. Im ersten Halbjahr des Jahres 1828 wurde das Versprechen eingelöst und an der damaligen Strasse von Hauzenberg nach Thyrnau, unweit des Wirtshauses (heute Gasthaus „Zum Stern“), eine kleine Dorfkapelle errichtet. Man baute in „Eigenregie“, wie man heute sagen würde. Dies missfiel dem kgl. bayerischen Landgericht in Wegscheid, zu dem die junge Gemeinde Oberdiendorf damals gehörte. 

 Die Höhe der Gesamtkosten wurde auf 630.000 DM veranschlagt. Am 2. Juli 1963 wurde der Plan durch die Regierung endgültig genehmigt, am 27. April 1964 wurde der Bauplatz ausgemessen und mit dem Kirchenbau begonnen.
Die Höhe der Gesamtkosten wurde auf 630.000 DM veranschlagt. Am 2. Juli 1963 wurde der Plan durch die Regierung endgültig genehmigt, am 27. April 1964 wurde der Bauplatz ausgemessen und mit dem Kirchenbau begonnen. 



 Herr Pfarrer, Dekan und Bischöflicher Geistlicher Rat
Herr Pfarrer, Dekan und Bischöflicher Geistlicher Rat
