 |
|
|
Seit dem hohen Mittelalter schlossen sich die Handwerker zur Zunft zusammen. In Hauzenberg waren die Zunft der Leinweber, Schneider, Drechsler, Schuhmacher, Maurer und der Steinhauer ansässig. Andere Handwerksgruppen (wie Bäcker, Hafner, Seifensieder usw.) waren in Nachbarorten einer Lade angeschlossen. (Foto: Norbert Leitner. Zunftlade von 1641 im Stadtmuseum Schärding)
|
|
|
|
 |
|
Zünftig organisiert … Das Wort Zunft leitet sich von „geziemen“ ab. Die Meister eines Handwerks waren also zu einer Gemeinschaft (Bruderschaft) zusammengeschlossen, die sich nach dem richtete, was sich ziemt. Was geltende Regel war, das war im Zunftbrief niedergeschrieben. Diese Handwerksordnung sorgte für ein geregeltes Miteinander innerhalb der Gilde, zugleich aber für ein prestigeträchtiges Wirken nach außen. Missachtung wurde bestraft bis hin zur Aberkennung des Meisterrechts. Die Zugehörigkeit zu einer Zunft war die Regel (Zunftzwang), denn nur wer seiner Zunft angehörte, konnte das erlernte Handwerk ausüben - und genoss "Schutz" durch die Zunft. 1. Handwerkern, die außerhalb der Zunft arbeiteten, wurde das Handwerk gelegt. Dazu gehörten: » Diejenigen, die von Tür zu Tür zogen, auf d’Stea gingen. Sie kamen nach Meinung der Zunftmitglieder zum Stören in den Markt. » Diejenigen, die ihre Ware billiger verkauften, und so den Zünftigen ins Handwerk pfuschten. » Die Stümper und Frötter, die ihre Ware im Gäu einer anderen Lade anboten. 2. Die Anzahl der Gewerbsgerechtigkeiten und der Meisterstellen in einer Lade regulierten die Zunftgenossen in Abhängigkeit von der eigenen wirtschaftlichen Lage.
… eigenständig und selbstbewusst 1. Wer ein Handwerk lernen will, muss männlich → von ehelicher Geburt und von → ehrlicher Herkunft sein Mit dem Aufdingen begann die Lehrzeit. Lehrjunge zu sein, bedeutete Arbeiten und Leben im Meisterhaushalt. Nach 3 Jahren erfolgte die Freisprechung zum Gesellen (Knappen). Die Gesellenzeit bildete den Auftakt für die Wanderzeit, d. h. Aufnahme in verschiedenen Meisterhaushalten, um die Fachkenntnisse zu vertiefen. Nach 2 Jahren wird ein vorgeschriebenes Meisterstück gefertigt. 2. Wer einen Betrieb führen will, braucht die Meisterprüfung → das Bürgerrecht → und eine Handwerksgerechtigkeit (Konzession) Die Gebühren an die Meister und an die Zunft zahlte der Auszubildende selbst. Bis zum Eintritt in die Zunft waren an die 30 Gulden zu berappen – eine Summe, die sich Anfang des 18. Jahrhunderts etwa durch den Verkauf von 2 Ochsen erwirtschaften ließ. Den größten Betrag musste der Prüfling wohl für das Meistermahl, die Verköstigung der Gäumeister bei der „Abschlussfeier“, bereithalten.
Alle ordentlichen und außerordentlichen Sitzungen fanden vor geöffneter Lade statt. Nachher ging’s dann zünftig her. Bis zur Einrichtung der Gewerbeschule im Jahr 1831 lag die Ausbildung allein in der Hand der Handwerksmeister.
Die Regelungen zur Vergabe des Bürgerrechts waren in der Ehaftordnung[1] festgelegt, die auf Jahrhunderte hin als das geltende Recht tradiert worden war. Sie besagt: „Wenn einer käme und Bürger werden wollte, so soll ihn der Richter ohne Wissen und Willen der Bürger nicht aufnehmen und derjenige der Bürger werden will soll binnen Jahr und Tag 65 Pfund Pfennige erlegen, und nach Rath der Gemeinde Bürger werden. Er soll seine Marktrechte bringen von dem Orte, wo er geboren ist, und dass er redlich weggegangen sei.“ Inwieweit war wohl für einen Auswärtigen der Anreiz für die Erwerbung des Bürgerrechts und die Aufnahme in die „Handwerkerschaft der Hauztenperger Gmain“ gegeben? Dieses Privileg war von jedem Bürgersohn beim Eintritt in das Arbeitsleben bzw. bei der Übergabe der Gewerbsrechte neu zu erwerben: „ … das handtgliebt abgestadtet zahlt er vor sein bürger Recht …“, so enden die Genehmigungen. Der Beitrag kostete zwischen 5 und 10 fl, dazu kam eine „Feuereimer Gebühr“ von 1 fl 30 kr. Die Brandbekämpfung war zu dieser Zeit Aufgabe der gesamten Bürgerschaft; wahlweise konnte auch ein Eimer in die Gemeinschaft eingebracht werden, der im Brandfalle zum Löschen verwendet wurde. [2] Das Handwerk bzw. das Recht ein Handwerk auszuüben, wurde vom Vater auf den Sohn vererbt; nur wer im Besitz einer Gewerbsgerechtigkeit war, durfte das Handwerk ausüben. Über Generationen hin wurden Gerechtsame innerhalb einer Familie tradiert und ausgeübt. (Weberfamilien, Schuhmacher, Schneider….)
Mit den Mitgliedsbeiträgen, die Meister und Gesellen an den Versammlungstagen in die Zunftkasse zahlten, wurden soziale Aufgaben finanziert. Aufgrund von Unfällen oder Krankheiten arbeitsunfähig gewordene Handwerker unterstütze man ebenso wie Handwerkerwitwen, denen es gestattet war, nach dem Tode des Ehemannes den Betrieb weiterzuführen. Auf diese Weise sicherten die Zünfte ihre Mitglieder sozial ab, zu Zeiten, als der Staat in diesem Bereich noch nicht aktiv war, von der Unterstützung der Spitäler, Siechen- und Armenhäuser, die meist auf bürgerliche Initiativen zurückgingen, abgesehen. Zudem kümmerten sich die Zünfte um die wandernden Gesellen. Erste Anlaufstelle in einer Stadt oder einem Markt war die so genannte Herberge, das „Stammwirtshaus“ der jeweiligen Zunft.
In der Herberge, in der die Zünfte ihre Sitzungen abhielten, stand die Zunftlade, eine hölzerne, in der Regel reich verzierte und aufwendig gearbeitete Truhe. Sie gehörte zu den Mobilien und wurde in hohen Ehren gehalten. Hier verwahrte man die Zunftkasse und die Symbole der jeweiligen Zunftgemeinschaft. In einer tabellarischen Bestandsaufnahme von 1826 sind die beweglichen Güter der sechs Hauzenberger Handwerkskzünfte beschrieben und monetär bewertet. (StAH 7/10) Drexler: „Eine hölzerne Lade wird umgeschlagen auf 16 fl; ein Schild 7 fl; 3 Handwerksbücher 3 fl; Signet 2 fl 24Kr.“ Maurer: „Eine seidene Fahne im Wert von 200 fl; hölzerne Lade 6 fl; Signet 5 fl; Meisterbuch und Freiheiten 9 fl; die ganzen Handwerksschulden 15 fl 20 Kr; Fahnkosten 4 fl 9 Kr.“ Schuhmacher: „Eine Fahne im Wert von 80 fl; Lade 6 fl; Signet 2 fl 24 Kr; Grundbücher 2 fl.“ Schneider: „Eine Kirchenfahne 102 fl; Lade in Wert von 6 fl; Schild 6 fl; Signet 2 fl 24 Kr.“ Steinhauer: „Lade 6 fl; Signet 3 fl 24 Kr; zwei Handwerksbücher 2 fl; Schild 6 fl.“ Leinweber: „Kirchenfahne im Wert von 120 fl; Lade im Wert von 12 fl; Signet 2 fl. 48 Kr; Schild 12 fl; Fahnenkasten im Wert von 10 fl; Hausschild 4 fl.“ Vor offener Lade wurden die Lehrlinge "aufgedungen" und die Gesellen "freigesprochen". Einer der Meister erledigte die Schreib- und Rechnungsarbeiten als „Ladenschreiber“, eine Tätigkeit, die entlohnt wurde. Man kann sich gut vorstellen, dass jede der zünftigen Gemeinschaften das gesellschaftliche, geistige und religiöse Leben in Hauzenberg in großem Maße mit bestimmte. Textbeitrag: Emmi Federhofer
Zum Weiterlesen: Loibl 1996 R. Loibl (Hrsg.), Das Geheimnis der Bruderschaft. Zunft und Handwerk in Passau, Passau 1996.
[1] StAH 2/17, Ehehaft und Marktgerechtigkeiten zu Hauzenberg 1359“ in einer Abschrift von 1802 [2] StAH 5/32, die Bürgerrechtsverleihungen von 1802 bis 1830
|
 |
|
|
Im mittelalterlichen/frühneuzeitlichen Markt blühte das Handwerk der Leinweberei. Der genügsame Lein, aus dem der Rohstoff Flachs (Haar) gewonnen wird, gedieh auf den kargen Böden unserer Region hervorragend. Die Gewinnung der Flachsfaser aus der Leinpflanze und die weitere Verarbeitung bis zum fertigen Ballen ist ein langwieriges und arbeitsaufwendiges Verfahren. (Foto: Julia Federhofer)
|
|
|
|
 |
||||||
|
||||||
Ain gantz ersams handtwerchDie Leinweber in Hauzenberg bis zur Gewerbefreiheit 18621. Das Zunftleben der Weber
Im Stadtarchiv Hauzenberg beinhaltet als ältestes Dokument zur Weberzunft ein Handwerksprivileg aus dem Jahre 1607, erlassen unter Bischof Leopold, Erzherzog zu Österreich die Ordnung des Handwerks der Webermeister im Land der Abtei.[1] So hatte jede Lade ein eigene Handwerksordnung, Vorschriften und Regelungen an die die Meister gebunden waren.
Wider die Handwerkfreiheit war, wenn ein Gäumeister seine Ware in der Stadt anbot. Im Jahre 1729 richteten die Weber von Passau eine Bittschrift an ihren Stadtrichter. Den Webern aus der Umgebung sollte es wie anderen Zünften auch, verboten sein, ihre Waren in der Stadt abzusetzen. Etliche unter den 24 Stadtmeistern, so heißt es müssten ihre Kinder betteln gehen lassen um ein Auskommen zu haben. (StAPa II A 394) Wider die Handwerksfreiheit war es auch, wenn die Passauer Lade Meister aus einem angrenzenden Gäu aufnahm. Als die Stadtmeister mehr und mehr ihr Terrain missachteten, setzte sich im Jahre 1735 die gesamte Weberschaft von Hauzenberg für die Wahrung ihrer Interessen ein. Anhand der im „Ordentl. Maisterbuch“ aufgeführten Weber wurde der Nachweis geführt, dass die Meister bis an die Ilzer Stadtmauer zum Gäu der Hauzenberger Weberlade gehörten. Das Verzeichnis reicht zurück bis ins Jahr 1642. (StAPa II A 416).
[1] StAH 2/8 Bereits von Miller 1953, 69 als schwer lesbar beschrieben, hat das Dokument im letzten halben Jahrhundert im Archiv lagernd weiterhin an Leserlichkeit eingebüßt. [2] Gey-, Gäumeister: Handwerksmeister auf dem Land, die sich in eigenen Zünften zusammenschlossen im Gegensatz zu den Meistern in Städten.
2. Vom Lein zum Leinen Über Jahrhunderte hin war die bedeutendste und zahlenmäßig am stärksten vertretene Branche die der Leinweber. Im Jahr 1825 arbeiteten in Passau 18 Leinweber, in Hauzenberg hatten zu dieser Zeit 45 Weber ihr Auskommen. „Durch 72 Hände“, so hieß es geht der Flachs bis er den Menschen kleidet. Für all die Arbeitsgänge von der Flachsernte bis zur fertigen, qualitätvollen Leinware musste der gewerblich produzierende Leinweber die obrigkeitlichen Vorschriften beachten. Im Jahre 1762 werden diese als die „Hochfürstliche Passauische Haar- Gespunst- Leinwad- und Beschauordnung“ in gedruckter Form vorgelegt. Die einzelnen Artikel gaben die Richtlinien für die gewerblich produzierenden Weber und Leinen-Beschaumeister vor. PDF
Vorbereiten des Rohmaterials: Raufen (1): Der Lein wird bei der Ernte büschelweise ausgezogen, die Erde von den Wurzeln geschüttelt und die Bündel zum Austrocknen gegeneinander gestellt. Noch tragen die Flachsstängel ihre geschlossenen Samenkapseln. Sie trocknen in der Sonne (2), um für den folgenden Arbeitsgang vorbereitet zu sein.
Riffeln (3): Damit die wertvollen Samenkapseln nicht verloren gehen, werden die Flachsbüschel durch die eiserne Riffel gezogen und die Samenkapseln abgestreift. Der Leinsamen wird für die Aussaat im nächsten Frühjahr aufgehoben, zum wertvollen Leinöl gepresst oder er verfeinert das Frühstücksmüsli.
Rösten: Danach muss der Flachs mehrere Wochen in wassergefüllten Gruben „anfaulen“ um die spinnbare Faser von den holzigen Anteilen im Stängel zu lösen (Wasserröste). Dasselbe Ergebnis ist zu erzielen, wenn die Büschel über Wochen hin der Witterung (4) ausgesetzt sind (Tauröste). Noch einmal müssen die Stängel durchtrocknen; in den weiteren Arbeitsschritten geht es darum, die Fasern herauszulösen.
Fasergewinnung: Brechen (5): Um die holzigen Teile der Pflanze entfernen zu können, werden die Stängel zuerst in der "Flachsbreche" gebrochen. Jeder Schlag knickt und splittert die holzigen Stängel, bis sie sich von der Faser lösen lassen.
Schwingen (6): Auf dem „Schwingstock" werden dann die holzigen Teile von der Flachsfaser abgeschlagen. Das Schwingrad mit den angesetzten Holzbrettchen wird durch Treten in Bewegung gehalten, der Schwingstock mit dem darüber gehängten Flachs gegen das Schwingrad gedrückt. Die groben Stängelteile fallen ab.
Hecheln (7): Die Flachsfasern werden durch „Bürsten mit eisernen Zähnen“ gezogen. Dabei trennen sich die kurzen von den langen Fasern. Es verbleiben die Fasern des Langflachses und die kurzen, wirren Fasern, der Werg oder Werch (Foto: Stadtarchiv Hauzenberg).
Spinnen und Haspeln (8, 9): Am Spinnrad wird aus den Fasern der Faden gesponnen, mit einer Haspel gewickelt und zu Strängen (Stren) geformt. (Stadtarchiv Hauzenberg). Sorgfältig wird Rocken um Rocken versponnen, der fertige Faden auf die Spule gewickelt. Das Garn einer vollen Spule wird zum Stren gehaspelt, der wiederum aus 10 Widel besteht. Wer das Garn nicht selbst verarbeitete, verkaufte es roh, gebleicht oder gefärbt auf den öffentlichen Jahr-, Garn- und Wochenmärkten.
Weben (10): Das fertige Garn wird im Webstuhl zu Leintüchern verarbeitet.
Bleichen (11): Die zunächst naturfarbenen Leintücher werden auf der Wiese aufgespannt und in der Sonne gebleicht.
Schon das erste „Fertigprodukt“, der Flachs, war Geld wert. Er wurde verkauft und über weite Strecken verhandelt. Flachshändler war der Vater von Adalbert Stifter. Er fand bei einem Unfall den Tod, als im Jahr 1817 in Oberösterreich sein mit Flachs beladener Wagen umstürzte. Als Abgabe sammelte sich Flachs auch in beachtlichen Mengen in den Zehentstadeln der Herrschaften. 6 Zentner vom Feinflachsvorrat und das über 4-5 Jahre hin versponnene Garn des Hauzenberger Pfarrherrn Eustach Kolbmann fiel dem Marktbrand von 1840 zum Opfer (OA Pfa Hauzenberg II, 6b). Geld ließ sich auch mit dem gesponnenen Garn verdienen, das in Püscheln angeboten wurde; ein Püschl (= 30 Stren) brachte im Jahr 1762 vier Gulden ein. Nur wer im Besitz einer Webergerechtsame war, konnte das Produkt weiter veredeln und mit dem fertigen Leinenstoff ein Zusatzeinkommen erwirtschaften.
3. Die Leinweberei Das Gewerbe war kleinbetrieblich strukturiert. Jede der Weberfamilien bewirtschaftete nebenher ein kleines Stück Land und besaß in der Regel weitere Handwerksgerechtigkeiten, die man je nach der wirtschaftlichen Lage unterschiedlich intensiv nutzte. Im 17. Jh. klapperten im Markt Hauzenberg mehr als 50 Webstühle (einschließlich der drei in Lacken). Die Anzahl der Weberrechte wie auch die Anzahl der Webstühle, die ein Meister nutzen durfte, setzte die Zunft (mit obrigkeitlicher Genehmigung) fest. Wer gab in der Weberzunft den Ton an? 2 Zechmeister: (Vermögens-)verwalter der Leinweberzunft 4 Viermeister: Überwachung der Zunftordnung, Prüfungskommission usw. 4 Beschaumeister: Kontrolleure, die die Qualität der Webwaren überwachten
4. Unter dem Siegel des Hochstifts Qualität vor Quantität – die Leinwandbeschau bei der Weberlade Bevor die Leinwaren zum Verkauf freigegeben wurden, mussten sie die Kriterien der Leinwandbeschau auf das Genaueste erfüllen. Sie wurde von den vier Beschaumeistern der Zunft dort vorgenommen, wo der Sitz der Lade war. Ein erstes Kontrollmerkmal bezog sich auf das geforderte Normmaß bei den fertigen Bahnen: Länge: 30 ½ Wiener Ellen (23,71 m) Breite: 5/4 Wiener Ellen (97 cm) Ware mit kleineren Abweichungen wurde mit dem kleinen Siegel gekennzeichnet. War eine Bahn mehr als 39 cm zu kurz, wurde sie zur Strafe in fünf Teile zerschnitten und dem Weber zurückgegeben. Beschaute und qualitativ hochwertige Leinwand trägt das „Beschausigill mit drey Feldern, in deren einem das Bild eines Wolfen, in dem zweyten der Namen des Beschauorts (Lade), in dem dritten die Jahrzahl steht“.
Kennzeichnung der Güteklassen mit Stern* in roter Farbe neben dem Beschauzeichen: * Kleiner Fehler bemerkt ** Mehrere kleine Fehler bemerkt *** Größere Fehler bemerkt – Ware der niedrigsten Preisklasse. Bei Fehlern, die als Nachlässigkeit des Webers zu deuten waren, wurde die Leinwad in gleich lange Stücke zerschnitten und zurückgegeben. Ein Fehler, der als vorsätzlicher Betrug ausgelegt wird: • Beim ersten Mal: der Stoff wird über quer in 10 Teile zerschnitten, dazu 6 Reichstaler Strafe • Beim zweiten Mal: Leibs- und Kerkerstrafe • Beim dritten Mal: Aberkennung des Meisterrechts. Während des 17./18. Jhs wurden bedeutende Mengen an Leinwaren erzeugt. Zwischen Verbraucher und Erzeuger hatte sich als unentbehrliches Glied der Händler eingeschaltet, der im Besitz einer Tuchhandelskonzession sein musste. Jedes textile Erzeugnis, das auf dem regionalen und überregionalen Märkten abgesetzt wurde, musste das Beschausiegel als Schutz- und Qualitätsmarke tragen. Für die im Jahre 1615 ohne Beschau für den Wiener Markt frei gegebenen 59 Stück Leinwand-Zwillich vom Fischer-Hof in Jahrdorf, hatten sich die vier Hauzenberger Beschaumeister vor Gericht zu verantworten.
Strafprotokoll. Die Zech- und Viermeister verklagen die Hauzenberger Beschaumeister Christoph Kaiser, David Deitl, Michael Weidinger und Hans Seidl wegen unterlassener Leinwandbeschau im Jahr 1615. (StAH 3/2)
Überlegungen zur Arbeitsleistung: 1 Stück = 30 Ellen 1 Wiener Elle = 77,75 cm 30 Ellen = 1376 m 1 m je Stunde: 115 Tage Arbeit bei 12 Std. 59 Stück Leinwand-Zwillich für den Verkauf fertigzustellen hatte ein Weber wenigstens 6 Monate Arbeit (ohne Sonn- und Feiertage).
5. Der Weberverein zu Hauzenberg von 1845-1862 (StAH 7/9)
|
||||||
 |
|
|
Die Lein- und Tuchwaren verarbeitete der Schneidermeister als Auftragsarbeit – den Stoff lieferte der Kunde mit. Die Schneiderwerkstatt mit der „bescheidenen“ Ausstattung an Arbeitsgerät, „ain Schneidter Schär, ain Öln, ain Pögleisen“, war in der Stube eingerichtet. So schneiderte man Tracht und Bekleidung, die zwar dem jeweiligen modischen Stil angepasst war, andererseits aber auch ganz besondere regionale Eigenheiten aufwies. (Abbildung nach: Hausbuch der Mendelschen Brüderstiftung der Stadt Nürnberg)
|
|
|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Schneiderhandwerk in Hauzenberg und die Schneider zu Wegscheid. Anno 1617
Wir N und N: Ain ganzs Ersambs handwerch der Schneider in Marrkht und Pfarr auch pej der Lad zu Hautzenperg bekhenen Alhie mit dissen schein nach deme mir an endt Pemeltes dato als wir in versambladen Handwerch gesessen sein für uns khommen sein nämblichen Acht Maister des Schneider Handwerch. Im Marrkht und Gricht Wegscheid mit VerMeltung wie sich alta im Marrkht Wegscheid solten handwergs ordnung Aufrichten oder aber pej /:ainer andern Lad:/ einverleiben altie weill dan ihr Vermögen khlein. Und handwerg ordung aufzufrichten vill khost pidten sich sambentlich mir solten sich neben uns in unser handwergs ordnung und frej haid einkhommen lassen. Hierauf haben wir ihr Pidt angesechen und sich neben uns einkhommben lassen. Doch der Mainung und gestalt, daß sich /:und die Irrigen jarlich:/ alles das Irige wellen aus sten was die freihaid und Red die… Ausweist der entgegen solten sich und die Irrigen auch für ehrlich wie handtwergs Prauch ist gehalten werden und zum Pistumb arbeiden dirrffen wie des per fürstlich Hoff pefelh ausweist dessen zu waren Urkhund und pessern Glauben hab ich Georg Khnedlseder und Lorenz Gindl als Ped Pürg und der Zeid angesetzte Zechmeister des Schneiders handtwergs alta zu Hautzenperg unsser Pedschaften hie firr gedruckht. Actum Hautzenperg vor offener Lad den 19ten februaris 1617 Jar. (StAH 2/11)
Im Jahr 1617 standen acht Schneidermeister vom Markt und Gericht Wegscheid vor der Entscheidung, eine eigene Handwerksordnung aufzurichten oder sich einer schon bestehenden Lade anzuschließen. Eine eigene Zunft zu errichten setzte einiges an Vermögen voraus, deshalb baten sie um Aufnahme in die, zu der Zeit bereits bestehende Hauzenberger „Handwerkszunft der Schneider“. Die hiesigen Schneidermeister erklärten sich damit einverstanden, insofern sich „die Bittsteller“ in die bestehende Ordnung einfügten. Sie sollten „ehrlich, wie Handwerksbrauch ist gehalten werden, und im Bistum arbeiten dürfen, wie das der fürstliche Hofbefehl ausweist.“ Unterzeichnet ist die Urkunde von: Georg Knödlseder und Lorenz Gindl, zu der Zeit Zechmeister des Schneiderhandwerks zu Hauzenberg. Vor offener Lade den 19. Februar 1617. Das Schneiderhandwerk besaß einen hohen Stellenwert. Außer den in obiger Urkunde genannten Zechmeistern der Schneiderzunft, Georg Khnedlseder und Lorenz Gindl, sind im 17. Jh. als weitere "Schneidereibetriebe" aus dem Nachlassinventar bekannt: Die Familien Khelbl, Haidöckher, Liebl, Wimmer und Daschner. Als Handwerkszeug werden aufgeführt: „Schneidter Schär, 1 Öln, 1 Pögleisen“. Catharina Gindtlin (gest. 1683) hinterließ außerdem „ein gespörte Truchen und darinnen ein cramerey von Spitzporten und unterschiedlichen Pändtl Werg“. Was die Schneidermeister im 17. Jh. an Tracht und Kleidung fertigten und mit welchen Materialien sie arbeiteten, ist aus den Nachlassinventaren zu erschließen. (StAH 4a/a-b) 2. Ein Blick in die Gwandtruchen und -trichel der Hauzenberger Bürgerschaft (1602-1702)Das Schriftgut zur Erforschung der Kleidungsweise beschränkt sich auf die Eintragungen in den Inventaren. Diese Verzeichnisse erfassten alle Kleidungsstücke, die zum Zeitpunkt der Inventur in den Truhen verwahrt waren. Gegen Ende des 17. Jhs. taucht auch der „Gwandtkasten“, der Schrank als Aufbewahrungsort auf. Ob Marktrichter oder Tagwerker, hier wurde die Feiertagskleidung, „das schöne Gewand“ aufbewahrt, das zu ganz bestimmten Anlässen getragen wurde. Falls eine nähere Beschreibung vorliegt, so sind die Kleidungsstücke nach Material- und Farbe beschrieben. Die fehlenden Angaben zum Aussehen in Form und Schnitt können Votivtafeln und Inschriftensteine (Reliefs) als bildliche Quellen ergänzen.
Das Grabrelief der Eheleute Augustin in der Hauzenberger Pfarrkirche St. Vitus
In den 1680iger Jahren ist das Epitaph für Hans Augustin und seine Frau Apollonia entstanden. Bis zum Kirchenneubau im Jahre 1972 gehörte es zur Ausstattung der Seelenkapelle, heute ziert es die so genannte Werktagskapelle. Das Relief in der unteren Bildhälfte zeigt die Eheleute Hans Augustin (links) und seine Ehefrau Appolonia (rechts) neben dem Kruzifix kniend in Gebetshaltung. Der Künstler hat sie in ihrer, zu der Zeit typischen Bekleidung abgebildet. Wie diese ausgesehen hat, lässt sich anhand der Nachlassinventare (Hans gest. 1683, Apollonia gest. 1686) weitgehend rekonstuieren.
» Die Kleidung von Hans Augustin Bürger, Metzger und Marktrichter (1676-1683) wohnhaft auf dem Bäckerhannesanwesen mit realer Wirth-, Bäcker- und Melbergerechtigkeit (heute Am Rathaus 5) hinterlässt bei seinem Tod folgende Kleidungsstücke: Ain Maner Mantl: bis zu den Kniekehlen reichender, ärmelloser Umhang Ain Khragen: starre, dicht gefältelte Halskrause der spanischen Mode entlehnt Ain schwartz lieder Hosn und Wames: die lederne Bundhose und Überrock Strimbf: baumwollene oder leinene, knielange Strümpfe preisserische Schur: Lederschuhe mit Schnürsenkel Ain Mader Hauben Haube aus Marderfell, als Zeichen der gehobenen sozialen Stellung
» Seine Ehefrau Appolonia Augustin hinterlässt nach dem Inventar von 1686 folgende Kleidungsstücke (die Angaben sind ohne genaue Farbbezeichnung): Ain Weiber Mandtl umhangartiger, ärmelloser, hüftlanger Umhang Ain Halsgwandt bis zum Hals hochgeschlossenes Kleid Khrägen gefältelte Halskrause, sog. „Mühlsteinkrause“ Hemeter Hemd unter der Kleidung, entsprechend dem Unterhemd getragen Under Pölz (das Kleidungsstück lässt sich nicht eindeutig zuordnen)
3. Die Schneiderzunft von 1702-1825(Beitrag in Bearbeitung) 4. Der Schneiderverein zu Hauzenberg von 1845-1862 (StAH 7/9; StAH 7/10)Mit dem Gewerbsgesetz vom 11. September 1825 tritt an die Stelle der Schneiderzunft der Schneiderverein. Der Einzugsbereich des Schneidervereins zu Hauzenberg erstreckte sich über die Gemeinden Germannsdorf, Oberneureuth, Gsenget, Thalberg, Breitenberg, Altreichenau, Lackenhäuser, Jandelsbrunn und Wollaberg. Damit ist die im Jahre 1837 von Seiten der Regierung getroffene Einteilung über die Zugehörigkeit der Gewerbsvereine berücksichtigt. Alle in diesem Vereinsbezirk ansässigen Schneidermeister, wie auch die Pächter von Gewerbsrechten mussten dem Verein beitreten. (StAH 7/10) Das Ehrenamt des Kommissars übernahm für alle in Hauzenberg ansässigen Gewerbsvereine der jeweilige Marktschreiber: Johann Nepomuk Bauer 1846-1858; Schermbrucker 1859-1861; Martin Pichler ab 1862. Sie waren zugleich die unmittelbaren Vorgesetzten des Vereins. Wenn dem nichts im Wege stand – so war es beschlossen – sollte die Jahresversammlung am Montag nach Bartholomä (24. August) abgehalten werden. Als Herberge bzw. Vereinslokal war das Gasthaus des Johann Friedl bekannt. Die ausführlichen Protokolle der regelmäßig abgehaltenen Vorstandssitzungen und Jahresversammlungen berichten über den jeweiligen Stand des Vereinsvermögens, die Handwerksausbildung und die Lehrlingssituation. Aufzeichnungen liegen ab 1845 vor. An der Spitze stehen zwei Vereinvorsteher und zwei Ersatzmänner. Die Vereinsvorsteher werden am Vereinsjahrestage, ebenso die Ersatzmänner auf 2 Jahre gewählt von den in der Versammlung anwesenden Gewerbsmitgliedern, stellvertretenden Werkführern und Pächtern von Gewerbsrechten. Abgestimmt wurde durch Akklamation. Zur Entscheidung genügte relative Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entschied das Los. Die Vereinsvorsteher oder deren Ersatzmänner vertreten den Schneiderverein in allen Angelegenheiten. Sie hatten das Vermögen und die Einkünfte zu verwalten, die Einhebung der Umlagen auf die Mitglieder des Vereins zu besorgen und die Unterstützungsvereine für die Gesellen zu leiten. Darüber hinaus galt es noch auf Anordnung der Behörden fachverständige Gutachten abzugeben. Zu den wichtigsten Aufgaben gehörte es, die Prüfung der Lehrlinge bei der Freisagung zum Gesellen beizuwohnen und hierbei die Gutachten hinsichtlich der Befähigung nach Prüfbericht und Gewissen auszusprechen.
Die Vereinsvorsteher und deren Ersatzmänner zwischen 1845 und 1863
Die „Anforderungen bei der Gesellenprüfung“ waren in den Statuten des
Die „Anforderungen bei der Gesellenprüfung“ waren in den Statuten des Schneidervereins wie folgt festgelegt:
„Am Tage der Prüfung hat der zu prüfende Lehrling einen unter Aufsicht eines Mitgliedes der Prüfungskommission gefertigte Arbeit dem Kommissär und dem Prüfungsmeistern vorzulegen und hat die an ihn gestellten Fragen über die Technik des Gewerbes dessen Stoffe, Werkzeuge und denen Anwendung genau zu beantworten, hat auch eine Zeichnung vorzulegen und an dem Prüfungstage selbst eine solche zu fertigen. Wer diesen Anforderungen nicht entspricht, hat noch weiteres zur Ausbildung in der Lehre zu verbleiben.“
Abbildung: Lehrbrief des Johann Zimmermann Schneidersohn von Penzenstadl, 1854 (Stadtarchiv Hauzenberg)
Tabelle: Lehrlinge und Gesellen des Schneidervereins Hauzenberg zwischen 1845 und 1863
Der Schneiderverein besaß an sich kein Vermögen; die Vereinsvorsteher besorgten die Einhebung der Beiträge, genehmigten die Ausgaben und entschieden bei Defizit über eine eventuelle Umlage. Sie hatten die Kasse unter „gemeinsamer Sperre“ und legten am Jahrestage Rechnung ab. Einnahmen zur Deckung der Vereinsausgaben: » Beitrittsgebühren der Gewerbeinhaber 10 fl » Beitrittsgebühren von Gewerbspächtern, 24 Kr je Jahr Pachtzeit » Jahresbeitrag von 24 Kr je Vereinsmitglied » Aufdinggeld 2 fl; Freisprechungsgebühr3 fl; » Beiträge der Gesellen, jährlich 12 Kr. (Leistung: Unterstützung dürftiger, auf Wanderschaft befindlicher Gesellen/Verpflegung kranker Gesellen und Lehrlinge)
Zahlungen aus der Vereinskasse: » Honorar für den Vereinsdiener Georg Friedl 2 fl » Zins an den Herbergsvater Johann Friedl 2 fl » Entschädigung der Vereinsvorsteher. » Prüfungsgebühr pro Gesellen 30 Kr » Für Benützung resp. Überlassung der Werkstätte 30 Kr pro Tag. Beide Gebühren müssen entrichtet werden, wenn auch der Lehrling die Prüfung nicht besteht.
Namen der Meister bei dem Schneiderverein des Marktes Hauzenberg. Notiz des Marktschreibers aus dem Jahre 1854/55 nennt 25 Meister aus dem Vereinsbezirk. (StAH 7/9) Hauzenberg: Georg Friedl, Michael Wimmer, Mathias Daschner, Johann Hüner (vermutlich als Johann Hiltner zu lesen), Johann Wimmer (später Josef Ziegler), Johann Schauberger, Johann Wimmer, Michael Bauer, Anhand der bis 1862 fortgeführten Vereinsprotokolle ist weiterhin zu ergänzen: Karl Francesco. Pfarrei Hauzenberg: Mathias Duschl, Peter Koll, Georg Zimmermann, Mathias Heiteneder, Andreas Reiter. Breitenberg: Mathias Greibel, Ignatz Bartelweber, Mathias Aldendorfer, Johann in Dalberg, zwei Meister in Fischerkling, Xaver Pfaelel in Althüten, zwei Meister in Brandweinhäuser, Eiwirt Leschek und Joseph Neimeier in Jandelsbrunn, Franz Leschek in Wollaberg und ein Meister in Rosenberg. In der Liste fehlt Mathias Ruprecht zu Gollnerberg, der 1851 in den Verein aufgenommen wurde. Unzureichend erfasst und lückenhaft erstellt:
Das letzte vorliegende Sitzungsprotokoll stammt von der Jahresversammlung am 1. September 1862. Damit enden die Aufzeichnungen des Schneidervereins. Textbeitrag: Emmi Federhofer Literatur und Nachschlagewerke: Zaborsky-Wahlstätten 1979 Zaborsky-Wahlstätten, Oskar von, Die Tracht im Bayerischen- und Böhmerwald. Eine Trachtenkunde Bd. 2, München 19792
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
Auch das Schuhmacherhandwerk war kleinbetrieblich organisiert. Die Anzahl und die Größe der Betriebe durch die Zunft reguliert, eine Produktion auf Vorrat war nicht gestattet. Jedes neue Paar Schuhe wurde so zur maßgefertigten Auftragsarbeit. Zum handwerklichen Können gehörte auch die Flickschusterei. Abgelaufene Absätze wurden repariert, durchgescheuerte Sohlen gedoppelt, Stiefel neu angesetzt und Kappen ausgebessert. (Foto: H. Reschke, Obernzell)
|
|
|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das ehrsame Handwerk der Schuhmacher
An Werktagen taten Schuhe aus Holz auch bei nassem Wetter oder auf steinigen Wegen den nötigen Dienst. Die mit wollnen (gestrickten) oder leinernen (genähten) Strümpfen bekleideten Füße steckten in Holz- und Böhmschuhen, die Werktags- und Arbeitsschuhe. Die Holzschuhmacher gehörten keiner Zunft an. Wer sich aufs Holzschuhmachen verstand und das nötige Werkzeug besaß arbeitete in den Winterstunden auf Vorrat – für einen kleinen Nebenverdienst. Sechs Paar hat angeblich ein geübter Holzschuhmacher pro Tag hergestellt. Kamen die Kinder im Sommer meist ohne Schuhwerk zur Schule, so waren es in der nasskalten Zeit und im Winter die schier unverwüstlichen Böhm- und Holzschuhe, die noch Mitte des 20 Jhs. an Schultagen das „gängige“ Schuhwerk darstellten.
Die Schuhmacherzunft in HauzenbergIn der Weberzunftordnung von 1591 war ausdrücklich verfügt, dass „kein maister und Gesell parfuaß“ zum Gottesdienst oder zu einer Beerdigungen erscheinen solle. Wer sich nicht daran hielt, war der Bruderschaft ein Pfund Wachs schuldig (StAPa II A 112). Es ist anzunehmen, dass diese Vorschrift auch für die anderen Zunftgemeinschaften galt. Lederschuhe für den Kirchgang und für besondere Festlichkeiten wurden angekauft bzw. bei den ansässigen Schuhmachern in Auftrag gegeben. Im Laufe des 17. Jhs. haben folgende Meister in Hauzenberg geschustert (Inventarien StAH 4a/a-b; die Zahlen in Klammern nennen das Sterbejahr). Georg Hofpaur (1626), Görg Paungartner (1660), Görg Mack (1665), Michael Heilingprunner (1666), Johannes Zwöckhinger (1694), Georg Griebl (1689), Michl Pamberger (1688), Stefan Maurer (1686), Johann Jell (1684), Hans Mack (1676), Johann Mack (1701). Bekannt ist außerdem ein Schuhmacher Thoma Paur, der 1638 seine Behausung in Hauzenberg verkaufte.
Lederschuhe gehörten in dieser Zeit zum Feiertagsgewand, das als das „gute Gewand“ in den Truhen verwahrt wurde. So wurden zusammen mit der Bekleidung in den Nachlassinventaren in der Regel auch „zwen Schurch“ oder „ain par Stifl“ aufgeführt. Ist bei Herrenschuhen die Machart genannt, so werden sie als „preisserisch Schur“ (Schuhe mit Schnürsenkel) beschrieben. Hans Augustin, Marktrichter (1676-1683), besaß außerdem ein „Par Bantdoffel“ – Schuhe ohne Fersenteil. Das Obermaterial ist meist dann hervorgehoben, wenn sie aus feinem Ziegenleder gearbeitet waren (cortawanisch, khartabaisch). (StAH 4a/a-b) Das Aussehen von spätmittelalterlichen/frühneuzeitlichen Schusterwerkstätten ist aus zeitgenössischen Darstellungen des 16./17. Jhs. bekannt. Die Verbindung von Werkstatt, Haushalt und Verkauf mag sich bis Mitte des 19. Jhs. nicht wesentlich geändert haben. Der Schuster Georg Hofpauren hinterlässt bei seinem Tod im Jahr 1626 in der Stuben „1 Schurchpruckh samt aller Zurgehörung“. Was in einer Schusterwerkstatt auf keinen Fall fehlen durfte, waren: ein Schursterstull, Laist (Schuhleisten), ein Werchstadt Drihel, ein Werkpänkhl, Pfalz- und Peißzangen, ein Khadereisen (Brenneisen), ein Schlag anth, Gneib (= Kneib, kleines Schustermesser), Ertel (Schusterahle, Pfriem) und ein Löder Ströckheisen.
Lederschuhe hatten ihren Preis. Nicht umsonst wurde als Entlohnung für Botengänge das so genannte „Schurgeld“, ein Obulus für die Abnutzung der Schuhe, bezahlt. Wer sich auf das Schuhmacherhandwerk verstand, bezahlte den Hauszins bisweilen mit ein paar neuen Schuhen. Insgesamt war das Schusterhandwerk gut organisiert. Die Lade war in Hauzenberg ansässig und die Zunftmitglieder achteten akribisch darauf, dass keine Ware von außerhalb in den Markt hereingebracht wurde. Im Jahre 1683 klagten die hiesigen Schuhmacher Johann Mack, Michl Pamberger, Görg Griebl, Johann Jell und Ulrich Baumgartner an Stelle des "ehrsamen Handwerks der Schuhmacher" gegen den Mitbürger und Tuchscherer Johann Gindl. Sie vermuteten in dessen Haus eine Niederlage (Niederlassung), wo „gemachte Arbeit verschlissen und verkauft wird“, obwohl er beim Bau seiner Behausung vor Richter und Rat und im Beisein der ganzen Bürgerschaft ein Gelübde abgelegt hatte, keinem Bürger Schaden zuzufügen. Was aber Gindl "irzundt schon vergessen und uns armen Schurmachern unser Stückl Brot wird abgeschnitten. Das war gegen die Handwerksfreiheit. Auch sein Sohn Christof Gindl, Lehrjunge bei Schuhmacher Daniel Lederer in Obernzell wurde bezichtigt, verkaufsfertige Schuhe in den Markt zu bringen. Nach der Handwerksordnung der Hauzenberger Schusterlade sollte keiner „frembde gemachte arbeit (in den Markt) herein bringen“. StAH 3/7 Es sei denn es handelte sich um gefrimte (bestellte) Arbeit. Um eine solche hat es sich wohl bei dem Auftrag des Marktrichters Hans Augustin (1703-1711) gehandelt, der nicht in Hauzenberg sondern in der Hafnerzell (Obernzell) fertigen ließ. Zwei paar Stiefel für den Richter Her Johannes Augustin von Hauzenberg Empfanngt seine Söhne und Frannz Anno 1705 an gemachter Arbeit auf bemelten Herrn Augustin umb 1 fl 54 Kr Fir ihm Herrn Augustin ein par Stifl angsözt 1 fl 30 Kr ihme ein par Stifl dopelt 20 Kr auf Bewilligung bemelten Herrn Augustin dem Frannzen ein neys par schuch 1 fl 24 Kr Herrn Augustin ein cortawanisch par Schuch: 1 fl 30 Kr Dem Studenten ein par 1 fl 9 Kr Herrn Augustin widumb ein par Stifl angesözt und die Kappe völlig veränndt ist darfür 1 fl 45 Kr Unterzeichnet: Johann Löderer Bürger und Schumacher alda (in Hafnerzell)
Für die Arbeiten die der Schumacher für den Marktrichter Augustin von Hauzenberg verrichtet hatte, berechnete er insgesamt 9 fl 32 Kr. Für den einen oder anderen ein kleines Vermögen. Dafür hätte er sich eine Kuh kaufen können, es hätte aber für die Meistergebühr seines Sohnes ausgereicht – wenn er seinen Lohn erhalten hätte. Im Jahre 1711 klagte der Schumacher gegen Johann Augustin. Mit mäßigem Erfolg wie es scheint, denn der Angeklagte war zur Gerichtssitzung nicht erschienen. Er ließ aber wissen, dass er den Schumacher wie auch die anderen Gläubiger bezahlen werde, wenn er seine „feisten Ochsen“ verkauft hätte. Klagen über die schlechten Zeiten sind wohl so alt wie das Handwerk selbst. Allerdings ließ die Beschränkung des Kundenstammes auf die Einwohnerschaft von Hauzenberg tatsächlich wenig Möglichkeiten für ein wirtschaftliches Wachstum. So stellte im Jahr 1825 der Schustermeister Joseph Griebl beim Magistrat von Hauzenberg Antrag auf Fortführung des Todtengrabergeschäftes nach dem Absterben seiner Schwiegereltern (Familie Penz). Ein zweites Standbein sollte zum bessern Auskommen seiner Familie beitragen (StAH 7/2). Im Jahr 1601 zählte der Markt 50 Häuser[1]. Für diese 50 Haushalte zuzüglich Schulmeister und Pfarrer, eine unbestimmte Zahl von Inwohnern und Nahrungsleuten (Austrägler) arbeiteten die Hauzenberger Schuster. Im Jahre 1804 ist die Anzahl der Gewerbsgerechtigkeiten deutlich überliefert, denn es entrichten acht Schuhmachermeister an das kurfürstlich Salzburgische Landgericht Thyrnau je 1 fl 30 kr an Steuer. Dem Namen nach sind das: Georg Asen, Martin Mack, Joseph Degler, Joseph Spindler, Franz Leierseder, Andreas Mack, Mathias Griebl und Christian Hainz. StAH 5b/30 Im Jahr 1829 zählt der Markt insgesamt 61 Häuser (einschließlich Kirche, Schulhaus und Amtsgebäude)[2]; zur Gemeinde gehören außerdem der Duschlberg, Lacken und die Kolleralm. Eine Schuhmachergerechtigkeit ruhte auf den folgenden Anwesen (nach Hausnamen)[3]: Schuhgeberlanwesen (Kusserstr. 9); Schusterberndlanwesen (Am Rathaus 1); Schuhmacheranwesen (Am Marktplatz 5); Schuhhannerlhaus (Marktstrasse 3); Schuhkasparanwesen (Bahnsteig 12); Schuhpausenanwesen (Marktstraße 16); Schuhhammelhaus (Marktstraße 10) und auf dem Schusteranwesen (?). Die acht Konzessionen bleiben bis zur Gewerbefreiheit im Jahre 1862 im Markt Hauzenberg erhalten. Nach dem bayerischen Gewerbe-Gesetz vom 11. September 1825 wurde die Schuhmacherzunft unter dem Namen Schuhmacherverein weitergeführt. Aufzeichnungen sind im Archiv ab 1845 erhalten.
Der Schuhmacherverein zu Hauzenberg von 1845-1862 StAH 7/9; StAH 7/10 Der Schuhmacherverein zu Hauzenberg war aus den Schuhmachermeistern der Gemeinden, Hauzenberg, Jahrdorf, Germansdorf, Schaibing, Windpassing, Oberneureut, Schauberg, Gegenbach, Breitenberg, Klafferstraß, Lackenhäuser, Schimmelbach, Altreichenau, Gsenget, Jandelsbrunn und Heindlschlag gebildet. 34 Gewerbsrechte bzw. Konzessionen zählte der Verein in den 1850er Jahren. Alle in diesem Vereinsbezirk ansässigen Meister, so wie die Pächter waren verpflichtet dem Vereine beizutreten. Immer wieder wurden bei den Versammlungen Schuster gemeldet, die das Handwerk ausübten aber dem Verein nicht beigetreten waren. Mit den so genannten „Pfuschern“ ging man hart ins Gericht. Die vom Vereinskommissar alljährlich akribisch geführten und zur Aufbewahrung abgelegten Protokolle geben Auskunft über Vermögenstand, Ausbildungssituation und es lassen sich auch die Namen der dem Hauzenberger Schuhmacherverein angeschlossenen Berufskollegen ermitteln. Die Jahresversammlungen fanden jeweils im Gasthaus des Jakob Gottinger (das Bäckerhannesanwesen, Am Rathaus 5), dem Vereinslokal der Schuhmacher statt; als Versammlungstag war der vierte Montag nach Ostern vorgesehen. Da Termin und Ort bekannt waren, hatten die Vereinsmitglieder ohne weitere Ladung zu erscheinen, jeder unentschuldigt ausgebliebene Meister zahlte eine Geldstrafe bis 1 fl 30 Kr in die Vereinskasse. Die Versammlungen hatten einen geregelten, stets gleichen Ablauf, der aus den Vereinsprotokollen folgendermaßen hervorgeht. „Am Jahresversammlungstag begeben sich um 10 Uhr die Meister in einem geordneten Zuge zur Pfarrkirche dahier und wohnen dem Requiem bei, welches für die verstorbenen Meister des Vereins gelesen wird. Nach abgehaltenen Requiem ziehen sie wieder in das Vereins-Lokal zurück.“ Den Versammlungsvorsitz hatte der Vereinskommissar. Die anwesenden Meister zahlen ihren Jahrschilling (Jahresbeitrag) und die übrigen Vereinsgebühren. Die Einnahmen des Vereins setzten sich zusammen aus: ¡ der Beitritts Gebühr neuer Mitglieder zu 10 fl ¡ den ordentlichen Jahresbeiträgen eines jeden Mitglieds à 24 Kr ¡ der Aufding- und Freisagegebühr 3 fl bei Meistersöhnen, 4 fl bei den übrigen Lehrlingen ¡ zur Unterstützung dürftiger, wandernder Gesellen oder zur Verpflegung kranker Lehrlinge und Gesellen wurden außerdem Gesellenbeiträge in Höhe von 12 Kr erhoben. Bei keiner Jahresversammlung fehlte eine Erinnerung an säumige Meister und Gesellen, die mit der Bezahlung der Beiträge aus verschiedenen Gründen in Rückstand geraten waren. Im weiteren Verlauf der Versammlung erfolgte die Prüfung der Vereinskasse. Waren die jährlichen Ausgaben höher als die Einnahmen, was nicht selten vorkam, so wurde der Fehlbetrag vom Herbergsvater Jakob Gottinger, nach dessen Tod (1850) von seiner Witwe Anna, vorgeschossen. Im folgenden Jahr war er wieder zurück zu erstatten, was natürlich einen ausreichend großen Aktivposten voraussetzte. Um das über Jahrzehnte in der Kasse bestehende Defizit decken zu können, musste schließlich ab 1855 jedes Vereinsmitglied neben dem ordentlichen Jahresbeitrag von 24 Kr noch einen außerordentlichen Jahresbeitrag von 12 Kr leisten.
Aus der Vereinskasse wurden folgende Ausgaben bestritten » Entschädigung der Vorstände für Reisen die außerhalb des Vereinsortes, zu Gunsten des Vereins unternommen wurden » Abfindung für den zweiten Vereinsvorsteher, der die Buch- und Kassenführung übernahm, zwei Gulden für die jährliche Rechnungsstellung. » Prüfungsgebühr von je 12 Kr für die zwei Vereinsvorsteher bei der Freisprechung der Lehrlinge. » Eine finanzielle Hilfe brauchten kranke wie auch arme Schuster. Als die Schulden zur Vereinslade auf 6 fl 24 Kr angewachsen waren, wurden Josef Öelbeck von Gegenbach auf Grund von Armut die Schulden erlassen. Auch die Aufding- und Freisagegebühr wurde mittellosen Schustern erlassen. Als weiterer Tagesordnungspunkt stand die Wahl der zwei Vereinsvorsteher an, die den Verein im nächsten Jahr zu vertreten hatten. Dabei rückte der zweite Vorsteher für das nächste Vereinsjahr als erster Vorsteher auf. Der 2. Vereinsvorstand und zwei Ersatzleute wurden durch Akklamation gewählt.
Tabelle: Vereinsvorsteher des Hauzenberger Schuhmachervereins zwischen 1847-1863
Schuhmachersöhne nutzten in der Regel den Vorteil, dass sie bei ihren Vätern in die Lehre eintreten konnten. Für das Handwerk waren zwei bis drei Jahre Lehrzeit vorgesehen, wobei nach der Befähigung des Lehrlings eine Verkürzung möglich war. Nach Ablauf der Lehrzeit und Ablieferung der Gesellenarbeit, die „Fertigung eines Paares Männer- und eines Paares Weiberschuhe“, wurden die Lehrlinge von der Lehre frei bzw. zu Gesellen gesprochen.
Joseph Hainz, Sohn des Schuhmachers Christian Hainz, geboren den 18 Mai 1813, meldet sich zur Gesellenprüfung. Die unterfertigte Prüfungs-Commission bezeuget nun auf Grund der mit ihm vorgenommenen Prüfung durch befertigen einer Probearbeit /:ein Paar Schuhe, daß derselbe zur gesellenweisen Ausübung des Schumachergewerbes gut befähigt befunden wurde.
Bisweilen war es vorgekommen, dass von den 34 Mitgliedern des Schuhmachervereins bei einer Jahresversammlung nur etwa ein Drittel der Meister anwesend war. Vor allem die Randbereiche des ausgedehnten Vereinsbezirkes waren nur spärlich vertreten. Die stundenlangen Fußwege etwa von Schimmelbach bei Neureichenau bis nach Hauzenberg hatte sich wohl der eine oder andere erspart und dafür lieber die Geldstrafe für unentschuldigtes Fernbleiben in die Vereinskasse gezahlt. Durch die Protokolle und Absentenlisten die bei den Jahresversammlungen geführt wurden sowie durch die Aufding- und Freisprechungsverzeichnisse sind die Meister des Hauzenberger Schuhmachervereins der Jahre 1845-1862 namentlich überliefert. Simon Stiaski von Haunersdorf, Johann Kaindlbinder von Schaibing, Johann Schichl zu Stüblhäuser, Joseph Oelbeck zu Gegenbach, Georg Eitel zu Wollaberg, Alois Schmid zu Gsenget, Ignatz Mehlchart zu Wollaberg, Raimund Urmann zu Breitenberg, Joseph Breitenfelner zu Schönberg, Joseph Höllmüller zu Schimelbach, Joseph Uhrman zu Neureichenau, Georg Gsellhammer von Wollaberg, Georg Wallanski von Klafferstrasse, Johann Buchberger von Altreichenau, Franz Schmöller von Jandeslbrunn, Joseph Reischl von Lackenhäuser, Paul Stockinger von Heindelschlag, Georg Kinadeter von Gsenget, Blasi Sonnleitner von Gegenbach, Karl Bayer von Gegenbach, Johann Hatzod von Gegenbach, Klaus Schmid von Gegenbach, Josef Steinigner von ? und Johann Hatzod von Gegenbach.
Unter der Ortsbezeichnung Hauzenberg werden in dem Zeitraum von 1845-1862 geführt die Schuhmachermeister: Johann Degler, Georg Mack, Anton Reidl (dann Joseph Reidl), Joseph Griebl, Franz Leyerseder, Joseph Binder, Franz Küspert, Joseph Hainz, sowie Josef Pilsl von Schröck, Florian Joseph von Germansdorf, Joseph Krenn von Germansdorf, Joseph Moser von Siglmühle, Johann Leierseder von Haag. Zahlenmäßig machen die im Markt ansässigen Schuhmachermeister mehr als ein Drittel aus. Mit dem Protokoll vom 12. Mai 1862 enden im Stadtarchiv die Aufzeichnungen über den Schuhmacherverein in Hauzenberg, das Schuhmacherhandwerk ist freigegeben.
[1] Nach dem Königsteuerverzeichnis aus dem Jahre 1601 [2] Ortsblatt Hauzenberg von 1829 [3] Nach den Liquidationsprotokollen von 1839 Textbeitrag: Emmi Federhofer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
Zusammenfassung des Beitrags hier eingeben...
(zum Vorschaubild: Ein Bäcker bei der Arbeit am Backofen im 17. Jh., vgl. Reith 1990, Abb. 2.)
|
|
|
|
 |
||||
Die Peckhen - die Bäcker
Hausnummer (alt) Hausname 13 Stadleranwesen 26 Bäckerhannesanwesen 31 Schreinerbäckeranwesen 32 Langsche Anwesen 38 Gottingeranwesen 66 Özgrisslanwesen 12 Riedlanwesen
Lage der Anwesen mit Bäckergerechtigkeit; Kartengrundlage: Ortsblatt Hauzenberg von 1829.
Seit jeher war das Bäckerhandwerk einem strengen Kontrollwesen unterworfen. So sind 1618 die drei Brotbeschauer zum „Richter khommen und ainen weckh gebracht welliches Marten Friedl gepachen der ist um 6 lodt zu kring gewesen auch das Prodt sei schwarz und ungeschmach gewesen“ StAH 3/1 (1 Lot = 16 g). Beanstandungen solcher Art waren nicht selten, sie mussten beim Marktgericht angezeigt werden. Für 1669 ist festgehalten, dass die Bäckereiwaren in vier wöchentlichem Zyklus zu kontrollieren sind, eine Qualitätskontrolle in Gewicht, Geschmack und Aussehen war gefordert. Dabei war es aber nicht immer die Nachlässigkeit eines Meisters, wenn das Brot nicht der „Norm“ entsprach, sondern es war auch von den Zutaten abhängig. 1796 klagen sämtliche Bürger und Bäckermeister, dass sie im Bräuhaus so schlechte und auch sehr wenig „Germb“ (Gärungs- und Backtriebmittel, das auch zum Brauen verwendet werden konnte) bekämen. Sie bitten, man möchte solche Germb herstellen wie von alters. Bräuverwalter war zu dieser Zeit Paul Daschner. StAH 3/20
Bisweilen wurden die Brotschauer als Brotwäger bezeichnet, denn in erster Linie war es das Gewicht des Brotes, das einer äußerst strengen Kontrolle unterlag. Die Brotwaren: Pfennigsemmel, Spitzwecken, Groschenwecken, Röckel (Roggensemmel), Dreierweckl und Sechskreuzer Wecken, wurden im Preis stets gleich gehalten. Was sich in Abhängigkeit von den Getreidepreisen änderte, war das Gewicht der einzelnen Brotsorten. Regelmäßig unterrichtete die Stadtschreiberei Passau den Marktrichter in Hauzenberg über die gültigen Getreide-, Mehl- und Brotpreise. Je höher der Getreidepreis auf dem Markt, desto kleiner wurden die Brötchen gebacken.
Tabelle: Die Umschrift der Preisregulative aus den zwei aufeinander folgenden Jahren 1801 und 1802 (StAH 2/39) – für uns heute nur unzureichend nachvollziehbar.
Aus dem Markt, für den Markt – Brotneid oder Existenzsicherung1671 verklagen die eingesessenen Hauzenberger Bäcker ihren Berufskollegen Görg Mayr. Grund: „der untersteht sich und schickt das Brot auf das Gey“, wie es im Verhandlungsprotokoll heißt. Der Verkauf von Brot über den Markt hinaus war von Seiten der Bäckerzunft strengstens untersagt. Und weil „öftermals 2 oder 3 Tag kein Brot vorhanden“ und schließlich auch „zur Notdurft der durch reisenden Leit“ sollte er besser den Markt versorgen und das hinaus schicken von Brot – eben bleiben lassen. StAH 3/5 Der Markt Hauzenberg mit seinen sieben Bäckermeistern war, wenn man so sagen will Selbstversorger, denn das Einführen von Brot war ebensowenig erlaubt. Auch Peter Ertl (Marktrichter 1694 bis 1703) hatte sich über den „Brotzwang“ hinweggesetzt. Für seine Gastwirtschaft schaffte er im Jahre 1703 das Brot aus Passau heran – 2 Säckh voll. Die Hauzenberger Bäcker (darunter Johann Lang, Johann Gottinger und Johann Friedl) setzten sich vehement zur Wehr und verklagten den Marktrichter. Der Brotzwang, an dem in Bayern sich bis zur Säkularisation im Wesentlichen nichts änderte wurde weiterhin beibehalten. Nur an Jahr- und Wochenmärkten durfte man bei den „herein bringenten Bäckhern khauffen, sein beliben ist kheinem verwörth.“ StAH 3/11 Die Kontrollmaßnahmen reichten sogar soweit, dass Bäcker aus den Nachbarorten zu den Wochenmärkten nicht am Vortag anreisen durften. 1682 wurde Urban Frey aus Wegscheid der Stimplerei angeklagt; hätte er Gries und Mehl schon am Vortag im Gey (Umland) verkauft, so hätte er wohl gegenüber seinen Berufskollegen einen Vorteil gehabt. StAH 3/6 Erst an der Wende zum 19. Jh treten entscheidende Veränderungen im Gewerbswesen ein, als unter der Regierung Montgelas die Zwangs- und Bannrechte aufgehoben wurden. Von nun an konnte die Bäckerzunft den Ein- und Verkauf im Umland nicht mehr verbieten. Konkurrenz belebt das Geschäft! Nach 1825: Wo der Gewerbsverein eingerichtet war, fanden die ordentlichen und außerordentlichen Zusammenkünfte der Zunftmitglieder statt. Vor diesem Hintergrund ist das von den 7 Hauzenberger Bäckermeistern eingereichte Gesuch um Erlaubnis zur Bildung einer selbständigen Innung in Hauzenberg zu verstehen. Das Gesuch wurde abgelehnt, denn sie erreichten nicht die zur Bildung eines Gewerbsvereins gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl – die war im Landgericht Wegscheid auf 8 festgesetzt. Man scheute keine Mühe. Um das Defizit auszugleichen erklärten zwei Melber, Andrä Ertl und Joseph Daschner sich bereit, der Bäckerinnung beizutreten. Solche gemischten Gewerbsvereine waren innerhalb verwandter Gewerbe durchaus üblich. In diesem Fall ließ sich jedoch die königliche Regierung des Unter-Donau-Kreises nicht erweichen. Vielmehr warf man den Hauzenbergern vor, eine Zersplitterung bereits bestehender Vereinigungen zu beabsichtigen. Man legte den "Bittstellern" nahe sich einer der beiden, im Gerichtsbezirk bereits bestehenden Bäckerinnungen – Untergriesbach oder Wegscheid – anzuschließen. Die erzwungene Entscheidung fiel schließlich auf Untergriesbach. Mit Schreiben vom 11. Januar 1838 wurde dem Bemühen der Hauzenberger, eine Bäckerinnung in ihrem Markt zu errichten ein Ende gesetzt mit dem deutlichen Hinweis an der nächsten Jahresversammlung in Untergriesbach, bei 1 fl 30 Kr Strafe, die in den Untergriesbacher Zunftschrein rollten, zu erscheinen. Die Bedenken der Hauzenberger Bäckermeister, dass sie durch „die hin- und herreise auf den bekannt beschwerlichen und weiten Wege irgend woandershin in unnöthige Kösten, in Zeitverlust und häuslichen Geschäftsnachtheil versetzt werden würden“ waren an den Türen der königlichen Regierung verhallt. StAH 7/6 Textbeitrag: Emmi Federhofer |
||||
 |
|
|
Schon in vorgeschichtlicher Zeit bereicherte Farbe den Lebensalltag der Menschen. In allen Kulturen entwickelten sich die verschiedensten Techniken der Farbgewinnung und der Farbanwendung. Auch das Hauzenberger Färberhandwerk setzte in der Frühzeit auf pflanzliche, tierische und mineralische Rohstoffe. In mehr oder weniger aufwendigen Arbeitsschritten, hier spielte das verwendete Naturgarn eine wichtige Rolle, entstanden die Produkte der Schwarz- und Bunt- oder Schönfärberei. (Vorschaubild: Blüten der Färberröte (Krapp), zum Rotfärben von Geweben verwendet)
|
|
|
|
 |
|||
Die Geschichte der Hauzenberger Färber
Wurden die gewebten Leinwandbahnen eingefärbt, so fiel diese Aufgabe in den Arbeitsbereich des so genannten Schwarzfärbers. 30 ½ Wiener Ellen (23,71 m) in der Länge und 5/4 Wiener Ellen (97 cm) Breite galten nach den Vorgaben in der „Hochfürstlich Passauischen Haar- Gespunst- Leinwad- und Beschauordnung“ aus dem Jahr 1762 als Normmaß bei den fertigen Webstücken. Diese Stoffbahnen beim Färbeprozess zu händeln war Knochenarbeit, für die anschließende Trocknung musste genügend Platz zur Verfügung stehen. Die Schwarzfärberei war mit der Leinweberei eng verbunden, allerdings wurde sie als selbständiges Gewerbe ausgeübt. Man kochte Eisensalze, Eisenoxide oder Feilspäne mit Gerbsäuren in Wasser um Rohleinen schwarz oder grau einzufärben.
Durch Bleichen wie durch Färben ließ sich die Leinware veredeln was bei der Beschreibung von Leinwäsche auch akribisch notiert wurde. Die Leinweberwitwe Catharina Pichlmaierin hinterließ 1723 in ihrem umfangreichen Nachlass „blob gestreifte Zirchen, gestraimbte Dischdircher, 1 blob gestraiftes Kissenzirchl und 24 Weiße, …“. Farbe gab den beige- oder horferbenen Rohleinen mehr Attraktivität. Nach den Farbbeschreibungen bei den Kleidungsstücken aus den Nachlassinventaren scheint auch in Hauzenberg seit Anfang des 17. Jhs. mit der gesamten zur Verfügung stehenden Farbpalette gearbeitet worden zu sein. Man trägt grau (dunkelgrau, hellgrau), schwarz, braun, blau (himmelblau, dunkelblau), weiß, rot (purpurfarben, hellrot), grün – und auch veilchenblau wird genannt. Noch verwendete man natürliche Farbstoffe, die aus Pflanzen, Hölzern, Mineralien oder tierischen Produkten gewonnen wurden und obwohl der Berufszweig des Bunt- oder Schönfärbers in unseren Schriftstücken nicht genannt ist, scheint man sich Farbstoffe, wie das Blau des Färberwaids oder das Rot der Färberröte (Krapp) zu Nutze gemacht zu haben. Auch das Färberhandwerk war zünftig organisiert, welcher Lade die Hauzenberger Färber zugehörten ist noch in Erfahrung zu bringen.
Als erster Färber ist 1601 der Schwarzfärber Hieronimus Spindlpaur auf dem Färberanwesen (heute Am Rathaus 12) namentlich genannt. 1613 kauft Pongraz Schärdinger, Bürger und Färber, des Spindlpauren Behausung. (StAH 4a/1) Ab 1629 ist der Bürger Hansen Frey als Schwarzfärber bezeugt. (StAH 3/3) Hans Frey stirbt im November 1663, seine Gattin Apolonia im Januar 1664. Das Ehepaar Frey hinterlässt eine gut eingerichtete Färberwerkstatt mit zwei Färberkesseln, Nass-Bottichen, Schäffern, Wannen und einer „Mang mitsamt der eisernen Ketten“. Die Mangel wurde gebraucht, um nach dem Färbevorgang bzw. nach dem Trocknen die Stoffbahnen zu glätten. Möglicherweise handelte es sich bei dem für 1641 in Hauzenberg bezeugten Schwarzfärber Michael Khrieger um einen Gesellen, der bei Hans Frey als Wandergeselle die Kniffe des Färberhandwerks erlernte. Außerdem legte ein Färberjunge mit Hand an. 1664 verdiente er 25 Kr je Woche – immerhin. (StAH 4 a/b) Sein Nachfolger, Ferdinand Mack hatte die Färbergerechtigkeit wohl nur wenige Jahre inne. Im Jahr 1670 beschließt die Witwe Maria Mack, sich „nach dem Absterben ihres Ehemannes“, mit dem Junggesellen Mathias Daschner (Bürger und Gastgeb, seines Handwerks ein Schneider) zu verehelichen. Sie übergibt die Behausung, so zwischen Hans Augustin und Jacob Lang gelegen. (StAH 4a/1) Weiterhin wird das Gewerbe von einem Schwarzfärber namens Bartholomäus Süß ausgeübt, wie in den Strafprotokollen von 1678 überliefert ist. Mathias Limpichler, Bauer zu Penzenstadl, bat vor dem Marktgericht um Hilfe, denn er hatte dem Schwarzfärber „6 Eln härbes Durch in die Farb geben und kann soliches von ihm nit haben, wann ich’s begehr gibt er mir nur leze Wort“. (StAH 3/6) Auch Bartholomäus Süß war nicht allzu lange im Geschäft, denn schon 1684 war die Färbergerechtigkeit im Besitz der Familie Asn: Christina Asn, Ehefrau des Bürgers und Schwarzfärbers Georg Asn stirbt im selben Jahr und hinterlässt bei ihrem Tod 5 Kinder: Georg, Maria, Agnes, Susanna und Barbara. Der Bäckermeister Simon Khölbl übernimmt deren Vormundschaft. Georg Asen bleibt auf dem Färberhaus und ist dort bis 1692 bezugt. (StAH 4a/2) In diesem Jahr verklagt er die Vormundschaft, weil die von seiner verstorbenen Hausfrau ihm zustehenden 63 fl Heiratgut ausständig seien. (StAH 3/8) Das Färberhandwerk verbrauchte für das Ansetzen der Färberbrühe (Flotte) in den großen Bottichen sehr viel Wasser. Nach den aufeinander folgenden Arbeitsgängen Waschen, Beizen, Spülen, Färben, wurde das übel riechende Farbwasser ausgegossen. Das gab nicht selten Anlass für Streitigkeiten mit Grundstücksnachbarn. Der Färbergeselle Franz Griebl bekam 1726 den Unbill seiner Mitbürger mit aller Härte zu spüren, als ihn am St. Michaelitag der Leinweber Josef Rieger dorthin zieht, wo er das „lähr Farbwasser hat ausgossen“. An die 30 Schaulustige hatten sich versammelt, als er ihm laut schreiend und mit ein paar Schlägen bekräftigt zu verstehen gab, dass er das nicht dulde. (StAH 3/14) Nach der Auflistung der bürgerlichen Gewerbe im kurfürstlichen Markt Hauzenberg hatte die Familie Griebl „das Rechten im 1699igsten Jahr erkauft“. Der eben genannte Franz Griebl ist gleichzeitig das erste namentlich bekannte Mitglied der Färberfamilie. 1760 übernimmt ein Mathias Griebl das Gewerbe von seinem Vater. Er hat im Jahr 1804 als Abgabe 5 fl zu leisten. Darüber hinaus sind für die Färbergerechtigkeit jährlich 2 fl 30 kr zur Lade zu zahlen (StAH 5/27; StAH 5b/30). Nachdem für den Markt zu keiner Zeit eine zweite Färbergerechtigkeit vergeben war ist anzunehmen, dass es sich bei dem Mitbürger und Färber Georg Pertlauer (gest. April 1710; StAH 4b/b) sowie dem Färber Caspar Rönhardt (belegt für das Jahr 1719), um Handwerkskollegen handelt, die in der Griebl’schen Färberwerkstatt mit gearbeitet haben. Der Sohn Xaver Griebl (bürgerlicher Färbermeister) führt das Gewerbe weiter. Er ist 1828 und 1833 als Zeuge bei Gewerbsangelegenheiten genannt. Nach seinem Tod heiratet die Witwe Anna Maria Griebl den Färber Johann Schwarzmeier. Anna Maria Schwarzmeier (seit 1838) hatte das Anwesen durch Heirat ihres 1. Ehemannes Xaver Griebl erworben (laut Brief vom 3. Feb. 1810). Diese Realitäten waren jedoch dem gegenwärtigen Ehemann Schwarzmeier „nicht angeheiratet“. Die Färberei bleibt weiterhin im Besitz der Familie Griebl. Im Jahre 1855 legt Alois Griebl ein Ansässigmachungs- und Verehelichungs-Gesuch beim Magistrat vor; er heiratet Walburga Koller und übernimmt das Färberhaus von seiner Mutter (StAH 7/3). Vermutlich aus einem Sicherheitsdenken heraus legte er im Jahre 1863, im „Auf und Ab“ der bevorstehenden Gewerbefreiheit, sein Meisterprüfungszeugnis noch einmal vor und ließ sich bestätigen, dass er mit der Übernahme des Anwesens Hsnr. 63 auch die reale Färbergerechtsame übernommen hat. Mit der Einführung der chemisch herzustellenden Anilinfarben erleichterte sich die Färbetechnik, auch die Arbeitszeit verkürzte sich um ein Wesentlich. Allerdings verschwanden nun die gewerblich produzierenden Leinweber, sie wanderten mit der Freigabe der Gewerbe in andere, lukrativere Berufszweige ab. Zudem wurde die Färberei mehr und mehr in die textilen Großbetriebe einbezogen. 1875 meldet Alois Griebl der bisher als Färber besteuert gewesen war, auf dem Haus Nr. 64 (die Hausnummern im Markt waren in der Zwischenzeit um eins erhöht) ein Lebzeltergewerbe an. Im selben Jahr übernimmt Ludwig Pfeiffer aus Breitenberg auf dem Anwesen Hsnr. 52 mit einem Gehilfen die Färberei in Hauzenberg. (StAH 7/16)
Großen Zuspruch hatten die Lebzelter auf den Jahrmärkten in Hauzenberg seit jeher erhalten. Ihre exquisite Süßware waren Lebkuchen, zu dieser Zeit ein Gewürzbrot das zu Wein oder Met gereicht wurde. Nach einem Münchener Rezept aus dem Jahre 1474 brauchte man für 650 g Roggenmehl: 1/4l Honig, 1/4l Wasser, 150g Sauerteig, 1 Teelöffel Salz, 1,5g Gewürznelken, 6g Zimt, 1,5g Pfeffer, 4,5g Ingwer und 3g Anis (Loibl 1996, 76). Die seltenen und teueren Gewürze machten Lebzelten zu einer Kostbarkeit, die es allerdings nicht nur an Markttagen zu kaufen gab. Anfang des 18. Jhs. hatten sich die Webereheleute Georg und Rosina Fesl einen kleinen Nebenerwerb mit dem Verkauf von Lebzelten und Kerzenwachs, einem weiteren wichtigen Erzeugnis dieser Branche, gesichert. Die Ware bezogen sie in Passau. Als im Jahre 1726 die Schulden auf die stattliche Summe von 25 fl 22 Kr angewachsen waren, klagte Johanna Effinger, eine Passauer Lebzelterin vor dem Marktgericht in Hauzenberg. Laut gerichtlicher Verfügung musste nun Georg Fesl den Ausstand im selben Jahr in fünf Ratenzahlungen begleichen. (StAH 3/14) Im Jahre 1834 richtete der Hauzenberger Wirt Martin Schreiner ein Gesuch an den Magistrat: [ … ] „man möchte ihn als Bürger Haus und Grundbesitzer im Markte ein neues personalles Lebzelter-Rechten ertheilen, indem im hiesigen Markte einmal zu viele Wirthe sind und von der Wirthschaft unmöglich zu leben und fort zukommen sei. Schließlich glaubt Bittsteller, für die hiesigen übrigen Wirthe ging ein großer Vortheil hervor, so nun selbe täglich den Rosoli, Meth und Lebzelten wolfeilen und von der ersten Hand bekommen könnten.“ Da von Seiten des Magistrates kein Genehmigungsschreiben vorliegt, wurde die Konzession vermutlich nicht erteilt. (StAH 7/6)
Erst im Jahre 1875 eröffnete Alois Griebl im Färberhaus eine Lebzelterei. Ob sein Unternehmen von Erfolg gekrönt war, geht aus den Quellen nicht hervor. Das ehemalige Färberhaus wird jedenfalls 14 Jahre später von der Marktverwaltung angekauft und von 1889 bis 1973 als Rathaus und Feuerwehrrequisitenhaus genutzt.
Das ehemalige Färberhaus (Am Rathaus 12), im 20. Jh. Im Bild links, als Rathaus und Feuerwehrrequisitenhaus; als Dienstgebäude der Polizeiinspektion Hauzenberg im Bild rechts. (Fotos: Stadtarchiv Hauzenberg) Textbeitrag: Emmi Federhofer
|
|||
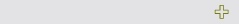
 Der Handwerksmeister darf heiraten und einen eigenen Hausstand gründen. Er ist stimmberechtigtes Zunftmitglied und er darf einen Handwerksbetrieb führen. Wer keine Gewerbsgerechtsame erben oder erwerben konnte, blieb ein Leben lang Gesell. Nur die Heirat einer Meistertochter oder Meisterwitwe konnte eine Werkstatt mit Konzession sichern.
Der Handwerksmeister darf heiraten und einen eigenen Hausstand gründen. Er ist stimmberechtigtes Zunftmitglied und er darf einen Handwerksbetrieb führen. Wer keine Gewerbsgerechtsame erben oder erwerben konnte, blieb ein Leben lang Gesell. Nur die Heirat einer Meistertochter oder Meisterwitwe konnte eine Werkstatt mit Konzession sichern.

 Jede Handwerkszunft hatte eine eigene Handwerksordnung, die für ein geregeltes Miteinander innerhalb der Gilde, zugleich aber für ein prestigeträchtiges Wirken nach außen stand. Im Jahre 1591 waren es die Leinwebermeister im Aigen und zur Pfarr Röhrnbach, die ein Gesuch an Bischof Urban zu Passau richteten, mit der Bitte um Errichtung einer
Jede Handwerkszunft hatte eine eigene Handwerksordnung, die für ein geregeltes Miteinander innerhalb der Gilde, zugleich aber für ein prestigeträchtiges Wirken nach außen stand. Im Jahre 1591 waren es die Leinwebermeister im Aigen und zur Pfarr Röhrnbach, die ein Gesuch an Bischof Urban zu Passau richteten, mit der Bitte um Errichtung einer  Auf dem flachen Land war das Weberhandwerk in eigenen Zunftgemeinschaften organisiert.[2] Das Gäumeisterbuch des Handwerks der Lein-, Barchent- und Zeugweber im Hochstift Passau (StAPa III 62 von 1711-1731), führt als Märkte mit Sitz einer Weberlade im Hochstift nördlich der Donau: Waldkirchen, Röhrnbach, Hutthurm, Perlesreuth, Hauzenberg, Griesbach, Wegscheid, Obernzell und Windorf. Mit 65 Mitgliedern, den Gäumeistern, bildete die Hauzenberger Zunft bereits im Jahre 1711 die mitgliederstärkste im Hochstift. Das Einzugsgebiet reicht bis an den die Ilz-Stadt-Mauern. Zu dieser Zeit sind Familiennamen wie Griebl, Ertl, Deitl oder Baumgartner aufgeführt, die auf mehr als ein weiteres Jahrhundert hin unter den alteingesessenen Weberfamilien die gewerbliche Leinweberei ausübten.
Auf dem flachen Land war das Weberhandwerk in eigenen Zunftgemeinschaften organisiert.[2] Das Gäumeisterbuch des Handwerks der Lein-, Barchent- und Zeugweber im Hochstift Passau (StAPa III 62 von 1711-1731), führt als Märkte mit Sitz einer Weberlade im Hochstift nördlich der Donau: Waldkirchen, Röhrnbach, Hutthurm, Perlesreuth, Hauzenberg, Griesbach, Wegscheid, Obernzell und Windorf. Mit 65 Mitgliedern, den Gäumeistern, bildete die Hauzenberger Zunft bereits im Jahre 1711 die mitgliederstärkste im Hochstift. Das Einzugsgebiet reicht bis an den die Ilz-Stadt-Mauern. Zu dieser Zeit sind Familiennamen wie Griebl, Ertl, Deitl oder Baumgartner aufgeführt, die auf mehr als ein weiteres Jahrhundert hin unter den alteingesessenen Weberfamilien die gewerbliche Leinweberei ausübten. Das Beschausiegel der Stadt Passau. Aus: „Hochfürstliche Passauische Haar- Gespunst- Leinwad- und Beschauordnung aus dem Jahr 1762
Das Beschausiegel der Stadt Passau. Aus: „Hochfürstliche Passauische Haar- Gespunst- Leinwad- und Beschauordnung aus dem Jahr 1762











 Hauzenberg den 5’ Mai 1857
Hauzenberg den 5’ Mai 1857

 In der Regel wurde die aus Naturgarn gewebte Leinwand im Freien gebleicht; durch die witterungsabhängige Sonnenbleiche erhielt Webware eine edle, weiße Farbe. Der Bleichvorgang konnte weitgehend oder vollständig eingespart werden, wenn eine Färbung vorgesehen war. Gefärbt wurde entweder die fertig gewebte Leinware oder das gesponnene Garn.
In der Regel wurde die aus Naturgarn gewebte Leinwand im Freien gebleicht; durch die witterungsabhängige Sonnenbleiche erhielt Webware eine edle, weiße Farbe. Der Bleichvorgang konnte weitgehend oder vollständig eingespart werden, wenn eine Färbung vorgesehen war. Gefärbt wurde entweder die fertig gewebte Leinware oder das gesponnene Garn. Eingefärbt wurde bisweilen auch das gesponnene Garn in Strähn; zum Aufhängen und Trocknen von Garnsträhnen gab es eigens dafür vorgesehenen Gestelle (im Bild links). Durch das Einweben der gefärbten Fäden konnte man am Webstuhl gestreifte oder karierte Stoffe erzeugen.
Eingefärbt wurde bisweilen auch das gesponnene Garn in Strähn; zum Aufhängen und Trocknen von Garnsträhnen gab es eigens dafür vorgesehenen Gestelle (im Bild links). Durch das Einweben der gefärbten Fäden konnte man am Webstuhl gestreifte oder karierte Stoffe erzeugen. 


